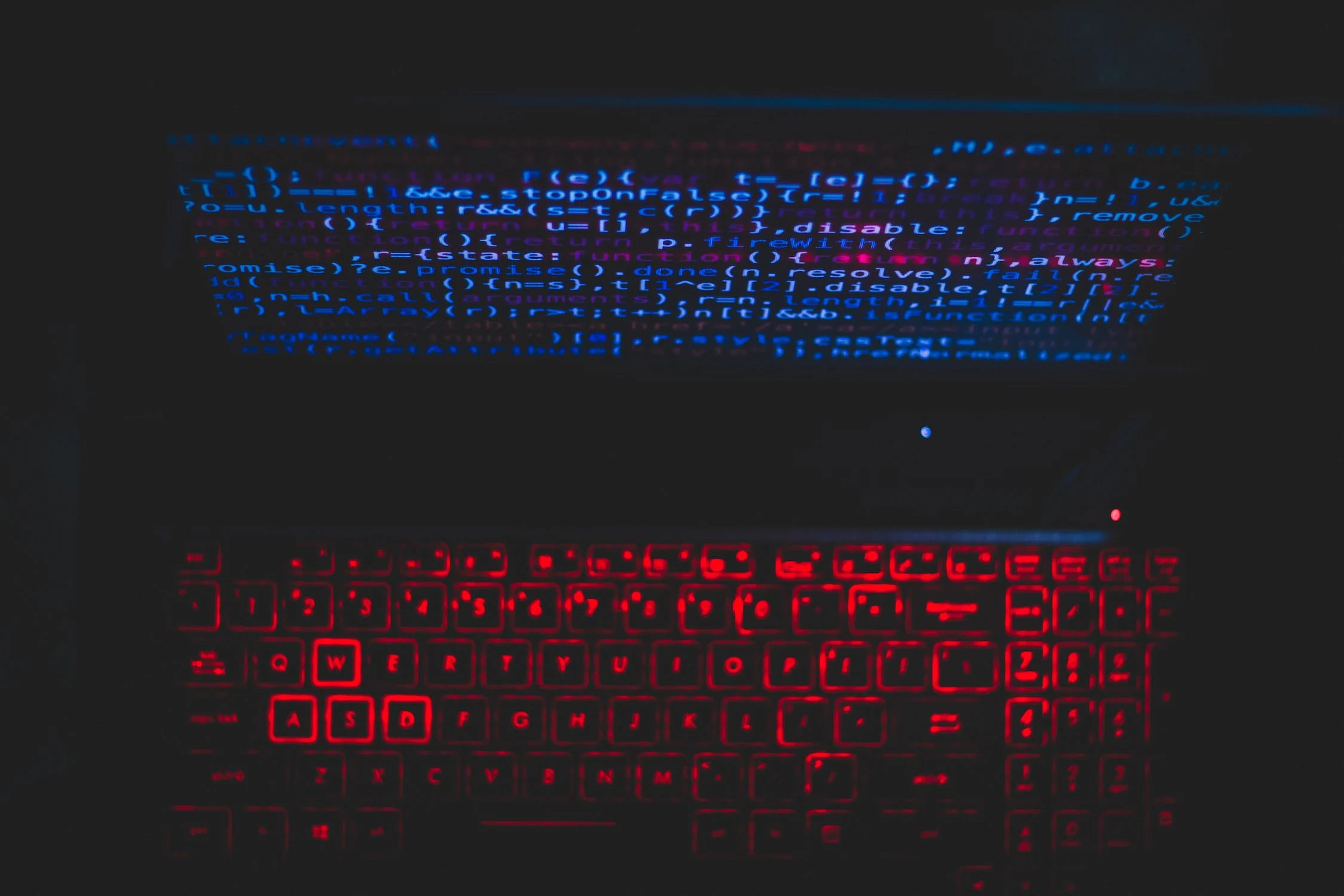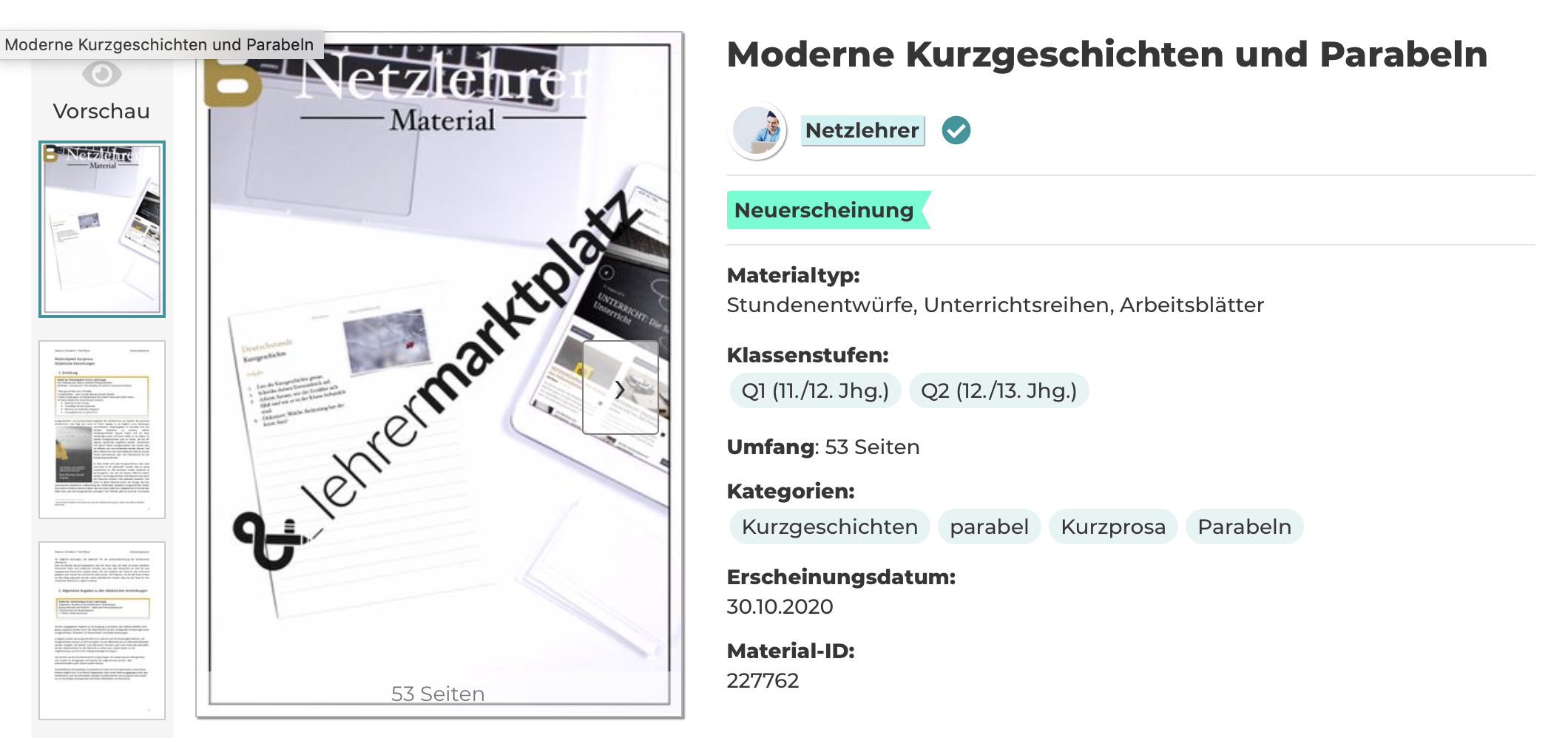[…] Wenn man Kurzgeschichten analysiert, gibt es zahlreiche Aspekte, auf die man achten kann, sollte oder muss. Dieses Analyseschema versucht viele dieser Aspekte nachvollziehbar zusammenzufassen und einige Hinweise mit auf den Weg zu geben. Eine Sammlung möglicher Kurzgeschichten findet sich hier. […]
UNTERRICHT: Kurzgeschichten-Sammlung

In diesem stetig weitergeführten Blogartikel finden sich einige Kurzprosatexte, die man für den Unterricht oder den eigenen Gebrauch verwenden kann. Dazu zwei Anmerkungen: Ich nenne den Artikel Kurzgeschichten-Sammlung, damit er über Google besser gefunden werden kann, auch wenn andere Kurzprosaformen dabei sind. Die Sammlung selbst ist das Ergebnis eines Prozesses, wie er in der Kultur der Digitalität typisch ist. Weitere, eigene Kurzgeschichten kommen stetig hinzu.
Übrigens: Wenn du Lesen und Schreiben genau so wichtig und sinnvoll findest wie ich, interessiert dich vielleicht mein kleines Debattenbuch, das im Januar beim Duden erscheint. Auch für Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern geeignet.
Material für Lehrer*innen
- Unterrichtseinheit zur Kurzgeschichte "Lavendel im Juni" (Social-Media, Schönheitsideale und Suizid)
- Einen niedrigschwelligen Einstieg in die Kurzprosaanalyse gibt es hier.
- An dieser Stelle kann man eine Textlupe zu Kurzprosatexten für alle Klassenstufen herunterladen.
- Hier gibt es Material, mit dem Schüler*innen Kurzgeschichten selbstständig bearbeiten können.
- Mit diesem Arbeitspaket können Kurzgeschichten mithilfe von Videos (auch in der Heimarbeit) bearbeitet werden.
- Moderne Kurzgeschichten und Parabeln - Unterrichtsskizzen, Arbeitsblätter und Lösungen
Anmerkung zur Entstehung
Es ist immer wieder erstaunlich, was die digitale Community gemeinsam leistet. Ein Beispiel ist diese Sammlung. Begonnen hat sie mit folgendem Tweet:
Was sind für euch die typischen Kurzgeschichten, die man in der Schule liest? #follower
— ⓑ² (@blume_bob) 15. Februar 2019
Die Antworten waren eigentlich ein Missverständnis. Denn anstatt jene Kurzgeschichten zu posten, die sehr häufig vorkommen (und damit eher langweilig für Lehrende sind), kamen viele sehr interessante Antworten zu Kurzgeschichten, die eher weniger bekannt sind. Das finde ich großartig. Deshalb bedanke ich mich nochmals herzlich bei allen Beteiligten und freue mich, dass nun viele profitieren können.
Da die hier folgenden Texte entweder vom Autor dieses Blogs stammen oder frei im Netz zu finden sind, gehe ich davon aus, dass die Sammlung an dieser Stelle keine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Falls dies der Fall sein sollte, bitte ich, dass man sich bei mir meldet: info[at]bobblume.de
Weiteres zum Thema Kurzgeschichten
Auf diesem Blog finden sich auch zahlreiche Hilfen zum Thema Kurzgeschichten. Auf einige sei an dieser Stelle verwiesen:
- Vorgehen bei einer Analyse
- Aspekte bei der Analyse von Kurzgeschichten
- Beispielinterpretation zu Sibylle Bergs "Nacht"
Weitere Ausführungen zum Thema Kurzgeschichten gibt es in dem Band „Endlich Kurzgeschichten verstehen". Dabei handelt es sich um eine Schülerhilfe, mit präzisen Tipps für bessere Interpretationen, Interpretationshilfen, vollständigen Interpretationen und einem großem Methoden- und Fachglossar.
Neue, nicht gelistete Kurzprosa
Lavendel im Juni (2025): Das Schlimme Ende eines Schönheitswahns
Die Zeit mit ihm (2025): Über die Bedeutung gemeinsamer Zeit
Dystopische Kurzgeschichte "USE 2030" (2025) über die USA im Jahre 2030.
Parabel "Der Bruder" (2021): Über Machtmissbrauch
"Schreibübungen" (2020): Unerkanntes Talent und Familiengewalt
"Menschen" (2017): Gespräch mit einem Außerirdischen, was menschlich ist
"Die Lektion" (2012): Wie man auf Gewalt reagieren kann
"Das bin doch ich" (2013): Die Kraft der Selbstreflexion
Inhaltsverzeichnis
Deutschstunde (2015)
Der Baum (2015)
Eine Nacht (2016)
Der Nachen (1914)
Scherben (2011)
Das Brot (1946)
Die Kirschen (1947)
Die Nacht im Hotel (1957)
Rückkehr (2006)
Eine Sucht
An manchen Tagen (2001)
Liebe (ca. 1937)
Das Karussell (1928)
Streuselschnecke (2000)
Mehmet (1988)
Gelb wie eine Zitrone (2013)
Weg (2008)
Tote Vögel
Meinjulilein (2013)
Nacht (2001)
Und in Arizona geht die Sonne auf (2000)
Saisonbeginn (1947)
43 Liebesgeschichten (1969)
Einseitig
Vorsicht Steinschlag! (2011)
Haare (2001)
Wimpertier (1995)
Deutschstunde (2015)
„Der Einstieg der Kurzgeschichte ist immer plötzlich, merkt euch das!“ Die Kälte war aus den undichten Fenstern in seinen Nacken gekrochen. Ganz hinten, wo er und Jana saßen, war es besonders schlimm. In den Augenwinkeln sah er, dass auch sie fror. Die hellen Haare auf ihren Armen standen nach oben.
„Was habe ich gerade gesagt?“
Herr Sternbergers Brust bebte. Er schritt gemächlich nach hinten, den Blick nicht von ihm gelassen. Seine Cordhose sah aus wie drei Erdschichten.
„Brauchen Sie eine Extraeinladung?“
Paul blickte am Lehrer vorbei, auf die Tafel. Sie war mit unleserlichen Zeichen beschriftet. Etwas Mathe vom Vortag, ein paar englische Vokabeln. Sternbergers Gesicht strahlte fröhlich. Kleine Äderchen zogen sich über die roten Backen vorbei bis zur furchigen Stirn. Die Augen verdrehten sich immer leicht, wenn er versuchte, ein Ziel zu fixieren. Deshalb fokussierte er immer nur wenige Sekunden, um sich dann scheinbar aus Zufall wieder wegzudrehen. Tat er dies, lachten die Schüler ihn aus und taten so, als habe jemand einen Witz gemacht.
Paul konnte seinen Atem sehen, als er ansetzte.
„Plötzlich!“, sagte Paul wie gehaucht.
„Seien Sie lauter, Mensch. Alle wollen hören, was Sie gesagt haben.“
Die anderen hören nichts. Sie starren gelangweilt auf kleine Kritzeleien vor ihnen, die sie während Sternbergers Monolog angefertigt haben. Nur Kreise und Ecke, mal eine unzüchtige Figur dazwischen, nichts Weltbewegendes.
„Plötzlich, Herr Sternberger! Kurzgeschichten beginnen plötzlich.“
„Warum denn nicht gleich so, Lustig?“, fragte Sternberger aber wartet die Antwort schon nicht mehr ab. Er betont den Namen, wie er es mag. Meistens, als habe er damit einen Witz gemacht. Er beginnt langsam und geschwollen, mit viel Schwere auf der ersten Silbe, danach gleitet seine Stimme nach oben, als wolle er ihm eine Frage stellen.
„Was will der Autor mit diesem Einstieg erreichen?“
Die Blicke der Klasse schweifen ins Leere. Jana sitzt weiter neben ihm und friert. Fror schon immer. Viele sagen, dass sei so bei Mädchen. Aber auch er friert. Er fixiert Sternberger, um sich abwenden zu können.
„Sprecht darüber mit euren Nachbarn.“
Paul schielt herüber. Aber Jana hat sich schon zu einer Dreierreihe gedreht. Es würde nicht lohnen, sich anzuschließen. Vielleicht wäre es wärmer? Er dreht sich zum Fenster.
Der Schnee liegt auf den Bäumen wie ein Meer von Blüten aus einer Welt, in der es kein Dunkel gibt. Die Häuser stehen fest im Boden und stoßen Leben aus. Der Rauch vor dem Schnee – eine Schattierung von Menschen. Aber ohne sie? Die Bäume weiter hinten sind in weiß getaucht. Sie suchen sich, stehen nah beieinander. Aber man sieht nicht, welches der wichtigste Baum ist. Alle sind gleich. Dunkeltannengrün. Wenn man jetzt durch den Wald streifen würde, wäre es sehr still. Schnee schluckt die Farben und die Töne. Die Tiere des Waldes sind im Winterschlaf oder im Süden. Der Weg ihrer Freiheit.
„Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Paul Witzig?“
Eine Gruppe ansprechen und einen meinen. Lehrerfolter. Herr Sternberger steht breitbeinig und lächelt ins nichts. Einige drehen sich weg, lachen. Er denkt, er sei lustig. Alle wissen: Er ist es nicht.
„Ich habe noch nicht zu Ende gedacht“, sagt Paul. Janas Gesicht neben ihm verzerrt sich. Sie prustet gleich los, darf es sich nicht erlauben.
„So wird das nichts mit dem Abschluss“, sagt Sternberger und fügt an: „So kann das nichts werden.“
Paul sagt nichts. Er hofft, dass er nun für den Rest der Woche seine Ruhe hat. Dass er nicht gefragt wird, von Sternberger und all den anderen, die ihm sagen, dass das nichts wird. Als er noch Fragen hatte über alles, was ihn interessierte, da war es anders. Aber die Fragen waren weg. Oder bei anderen. Und Antworten hatte er noch nie gehabt.
Die Klingel riss alle wie mit einer durchsichtigen Schnur nach oben. Sie fielen wie im Sturz aus der Klasse heraus, laut tönend und tollend, was nun, endlich, da die Schule vorbei sei, anstünde.
Paul atmete tief durch und verfolgte den Atemhauch, der es bis über den Tisch schaffte, ehe er sich auflöste. Er stand auf, langsam, als müsse er sich in Zeitlupe bewegen.
Sternberger musste noch etwas auf die Tafel geschrieben haben, das ihm zuvor entgangen war. „Der Schluss…“ hieß es dort.
Paul packte seine Sachen ein und ging näher an die Tafel. „Der Schluss ist meistens offen.“ Was sollte das bedeuten? Offen. Es gibt also kein Ende? Kein Happy End? Keine Auflösung.
Ein plötzlicher Beginn und keine Auflösung am Ende. Zum ersten Mal an diesem Tag, nein, in dieser Woche, musste Paul grinsen. Die Merkmale der Kurzgeschichte entsprachen nicht nur Sternbergers Schulstunden.
Eigentlich entsprachen sie dem ganzen Leben.
Schade, dass er das niemandem mitteilen würde. Es würde keiner zuhören wollen. Nur Gelächter, Blicke, kleine Zeichnungen auf Papier.
Das dunkle Brechen unter seinen Schritten begleitete seinen Gang durch den Schnee. Er klopfte an der Haustür, wo seine Oma die Arme ausbreitete. Ein kleiner Punkt auf der Schürze verriet ihm, dass es Gulasch geben würde. Das machte ihn glücklich.
„Gulasch!“, sagte er freudig.
„Weißt du, mein Paulchen“, sagte seine Oma. Ich glaube ich kennen keinen, der so gut beobachten kann wie du.“
Bob Blume
Der Baum (2015)
Der Weg auf den abgelegenen Hügel sah zu jeder Zeit anders aus. Während im Frühling die Pflanzen wucherten und die Luft von Insekten brummte, war es im Winter karg und dunkel. Aber dafür konnte man schon kurz vor der Kuppe, an der nur noch eine letzte Anhöhe folgte, in die Weite der Täler blicken. Eben an jenem Punkt, der ein ganzes Panorama nach allen Seiten bot, wuchs ein Baum.
Der ältere Mann, dessen Silhouette nun in unsere Sicht wandert, hatte diesen Baum schon gekannt, als dieser mehr als Wildwuchs schon im leichten Windzug gebogen wurde. Der damals junge Mann hatte sich, einen warmen Schluck Tee in der mitgebrachten Thermoskanne und ein Käsebrot in einem kleinen braunen Lederrucksack, neben den Baum gesetzt und nachgedacht.
Weiter hatte er nichts mitgebracht, da die Umgebung samt feinem Bäumchen anbot, sowohl weit in die Gegend zu schauen, als auch die einfachen Dinge der Welt wahrzunehmen. Das Nachdenken erfolgte quasi als Nebenprodukt, als Arbeitsfeld, das in Zeiten des vorbeieilenden Lebens oftmals unter den großen Ästen der mittelbaren Gedanken versteckt.
Schon damals glaubte der nun hier sitzende alte Mann, dass der Baum das schwerere Los gezogen hätte. Er konnte nur das tun, was in seiner begrenzten Macht lag und musste Veränderungen in aller Langsamkeit reagieren, die es sein Stamm und seine Zweige, seine Blätter und einige wenige Knospen zuließen. Er konnte nicht einfach weg, die Wurzeln zusammenpacken und sich aufmachen, um neben einem Menschen diese Wurzeln wieder zu schlagen. Er konnte nur in großen Dimensionen denken, die Blätter sprießen, arbeiten oder zuletzt abfallen lassen.
Der Mann hingegen sah seine Freiheit als Mensch, als er neben dem Baume sitzend über die nächsten Minuten nachdachte. Gedanken, die der Baum sich nie machen könnte.
Und wenn Jahre vergangen waren und der Mann sah, wie der Baum zwar schon kräftiger geworden, aber eben immer noch Baum an der gleichen Stelle wogte, oder in der ihn umzingelnden Sonne brannte, dann fühlte er ein unbeschreibliches Glück, Mensch zu sein.
Was würde der Baum denken?
Eine verwegene Frage, die sich der Mann in dem Augenblick stellt, da er eines morgens wieder einmal den Weg in den Wald gemacht hatte, den er aufgrund der angenommenen Verbindung mit dem Baum nun seinen eigenen nannte.
Würde der Baum seine Beschränkung wahrnehmen und dafür danken, dass die Wahrnehmung eines Menschen überhaupt erst Relevanz in sein ewig dastehendes Leben brachte.
Oder würde der Baum alles aussitzen. So lange Schweigen, bis der Mensch selbst darauf käme, dass nicht die Gedanken über das Leben des Baumes die Fehleinschätzung darstellte. Dass es nicht der Baum war, der nicht vom Platz kam, da dem Baum der Platz ganz egal ist. Da er hier doch Sonne, Wind und Wetter hat; Dass auch die Menschen um ihn herum, oder einer, der Mensch, ganz egal sind.
Aber dass der Mensch in seinem egozentrischen Gedanken der einzige ist, der das Leben des Baumes so nachhaltig verändern kann, dass nichts mehr von ihm übrig bleibt, nicht einmal Nachkommen.
Und vielleicht dächte dann der Mensch daran, warum er immer wieder hierhin kam, nur um darüber nachzudenken, dass er ganz anders sein wollte und woanders.
Bob Blume
Eine Nacht (2016)
„Werden wir diesen Abend jemals vergessen?“, fragte sie wie in die Nacht hinein, deren tiefes Schwarz nur vom dunklen Grün des über ihnen thronenden Baumes unterbrochen wurde. Er wartete eine Weile zu lange, bevor er die Antwort gab, die nicht nötig gewesen wäre. „Jemals“, dozierte er, „ist ein großes Wort. Keiner kann…“ Er sprach nicht mehr weiter; er wollte die Stimmung nicht zerstören, nicht jetzt.
„Weißt du“, sagte sie nun in seine Richtung, „manchmal ist es besser, wenn man nicht so viel zu wissen glaubt. Erfahrungen behindern die Hoffnung auf Überraschungen.“ Er nickte unmerklich und strich mit seinen Händen über das dicke Gras. Nach diesem Tag voller unverständlichen Wisperns über das, was der eine und die andere über Liebe dachte, dicken Schweißtropfen auf dem Weg zur Lichtung, einem ausgedehnten Picknick mit Früchten und geschmierten Broten auf einer zu kleinen Decke – nach diesem Tag war der Abend nicht als Ende geplant worden. „Jemals“ wiederholte sie, dieses Mal weder in die Nacht noch zu ihm. Er versuchte, seine Hand über ihre zu streichen, zog aber im letzten Moment zurück. Eine Unsicherheit hatte Besitz von ihm ergriffen, obwohl er selbst wusste, dass es nur die Kälte war, die langsam unter ihre Kleidung kroch.
„Wir können nochmal hier her kommen“, sagte er, als wolle er sich selbst beschwichtigen.
„Nein“, sagte sie und lächelte.
Viele Jahre später ging er den Weg zur Lichtung; nichts kam ihm bekannt vor und er fühlte sich unsicher. Kam zum Baum. Setzte sich. Versuchte irgendein Gefühl heraufzubeschwören. Es war weg. Nur eine Traurigkeit blieb wie an einen verstorbenen Bekannten. „Jemals“, hauchte er in die Luft und kam sich lächerlich vor.
Irgendwo anders lachte eine Frau ein lautes, unbeschwertes Lachen. Sie dachte nie wieder an diese eine Nacht unter dem Baum. Sie hatte ihn vergessen.
Robert Walser
Der Nachen (1914)
Ich glaube, ich habe diese Szene schon geschrieben, aber ich will sie noch einmal schreiben. In einem Nachen, mitten auf dem See, sitzen ein Mann und eine Frau. Hoch oben am dunklen Himmel steht der Mond. Die Nacht ist still und warm, recht geeignet für das träumerische Liebesabenteuer. Ist der Mann im Nachen ein Entführer? Ist die Frau die glückliche, bezauberte Verführte? Das wissen wir nicht; wir sehen nur, wie sie beide sich küssen. Der dunkle Berg liegt wie ein Riese im glänzenden Wasser. Am Ufer liegt ein Schloss oder Landhaus mit einem erhellten Fenster. Kein Laut, kein Ton. Alles ist in ein schwarzes, süsses Schweigen gehüllt. Die Sterne zittern hoch oben am Himmel und auch von tief unten aus dem Himmel herauf, der im Wasserspiegel liegt. Das Wasser ist die Freundin des Mondes, es hat ihn zu sich herabgezogen, und nun küssen sich das Wasser und der Mond wie Freund und Freundin. Der schöne Mond ist in das Wasser gesunken wie ein junger kühner Fürst in eine Flut von Gefahren. Er spiegelt sich im Wasser, wie ein schönes liebevolles Herz sich in einem andern liebesdurstigen Herzen widerspiegelt. Herrlich ist es, wie der Mond dem Liebenden gleicht, ertrunken in Genüssen, und wie das Wasser der glücklichen Geliebten gleicht, umhalsend und umarmend den königlichen Liebsten. Mann und Frau im Boot sind ganz still. Ein langer Kuss hält sie gefangen. Die Ruder liegen lässig auf dem Wasser. Werden sie glücklich, werden sie glücklich werden, die zwei, die da im Nachen sind, die zwei, die sich küssen, die zwei, die der Mond bescheint, die zwei, die sich lieben?
Marlene Röder
Scherben (2011)
Ich bin unvorsichtig geworden. Wie schnell das geht. Zu Hause wäre mir das nie passiert. Ich bin müde, daran liegt es. Seit ich hier bin, könnte ich die ganze Zeit nur schlafen.
Sie haben mir ein Zimmer gegeben mit Modellflugzeugen, die von der Decke hängen. An eine Wand ist ein Regenbogen gesprayt. „Was ist denn das für ein Babyzimmer?“, hab ich gefragt. Ich bin fast vierzehn, Mann.
„Das ist das Zimmer von meinem Bruder“, hat das Mädchen gesagt, und Alter, wie die dabei geguckt hat. Als würde sie mir jeden Knochen im Leib einzeln brechen, wenn ich die Scheißflugzeuge auch nur schief angucke.
„Und wo ist er, dein Bruder?“, hab ich gefragt. Weil, hey, ich hätte ein Problem damit, wenn meine Alten einfach jemand in meinem Zimmer pennen lassen würden, selbst wenn es ein Babyzimmer ist. Aber diese Pfarrerskinder, die sind wohl sozial erzogen. Nächstenliebe und so was.
„Er ist tot“, hat sie gesagt und auf den Fußboden geschaut: „Er hatte Muskelschwund.“ Ich starre sie an und stelle mir einen Jungen vor, der sich langsam auflöst, die Muskeln flutschen zurück wie Spaghetti, bis er nur noch ein Häufchen Knochen ist, überspannt von Haut.
Und auseinanderfällt.
Bestimmt hätte ich da was sagen sollen, irgendwas mit herzlich … Aber das Einzige, was mir eingefallen ist, war herzlichen Glückwunsch, und das passte ja wohl nicht. Also hab ich nur gesagt: „Toll, das Zimmer von ’nem Toten.“
Auf dem Schreibtisch steht sogar noch ein angefangenes Modellflugzeug, steht da wie in einem Scheiß-Museum, und manchmal bastle ich ein bisschen dran rum, nur um die Pfarrersippschaft zu ärgern.
Neulich kam der Pfarrer himself ins Zimmer, um irgendwelches Gerichtszeug mit mir zu besprechen. Ich hab gesehen, dass er es sofort gemerkt hat, er hat auf das Flugzeug gestarrt und ich dachte, gleich fängt er an zu flennen oder scheuert mir eine, aber stattdessen hat er mich angeguckt und dann hat er versucht zu lächeln.
Kein Wunder, dass man da lasch wird. Dass man nicht mehr aufpasst, dass man vergisst, die Tür abzuschließen, wenn man morgens mit müdem Kopf ins Bad trottet. Zu Hause wär mir das nie passiert.
Ich stehe in Boxershorts vorm Waschbecken und spüle mir die Zahnpasta aus dem Mund. Als ich wieder hochgucke, sehe ich in dem großen Spiegel, dass das Mädchen hinter mir in der offenen Tür steht. Sie starrt mich an, starrt meinen Rücken an, die Striemen, wo der Arsch mich mit dem Gürtel … Und meine Mutter, die zugesehen hat, bisschen geflennt, aber zugesehen …
Und jetzt sieht das Mädchen das alles, und ich steh da mit einem Rest Zahnpasta im Mundwinkel und hab mich noch nie so scheißnackt gefühlt. Ich wirbel herum, aber ihr Blick geht an mir vorbei, es ist immer noch alles sichtbar im Spiegel, und wie kann das sein, dass sie morgens schon so aussieht, mit dem langen, rotbraunen Haar, das ihr über die Schulter fällt, makellos, ja, das ist das Wort. Ihre Augen sind geweitet, sie guckt mich an wie etwas, was runtergefallen und kaputtgegangen ist, schade drum. Und dann gräbt sich diese Furche in ihre Stirn – oh, tut mir so leid für dich – und am liebsten würde ich sie schlagen. Stattdessen schreie ich sie an und schmeiße meine Zahnbürste nach ihr, dass der Schreck das andere in ihren Augen auslöscht. Ich schmeiße auch den Zahnputzbecher und die Cremes, den Rasierapparat und überhaupt alles, was in Reichweite ist. Aus einem kleinen Schnitt am Kinn des Mädchens tropft Blut, aber es bleibt immer noch stehen. Zuletzt knalle ich die Seifenschale aus poliertem Stein gegen den großen Wandspiegel. WUMM! Mit einem befriedigenden Krachen explodiert er und die Scherben regnen glitzernd runter. Da läuft sie endlich weg.
Mein Herz hämmert. Mir ist so heiß. Ich will meine Haut ausziehen und das alte zerknüllte Ding in den Korb für die schmutzige Wäsche schmeißen. Ich will mich hinlegen, mit dem Gesicht auf die kühlen Fliesen, ’ne Runde ausruhen. Aber das geht nicht, alles voller Scherben.
Das war’s wohl mit dem Pfarrershaus. Nachdem ich ihr Bad zerlegt habe, schmeißen die mich raus. War ja klar, dass so was passiert. Aus irgendeinem Grund muss ich an das halb fertige Modellflugzeug denken, während ich in diesem Trümmerhaufen rumstehe. Alles voller Scherben und ich bin barfuß.
Kein Ahnung, wie ich hier je wieder wegkommen soll.
Es klopft an der Badezimmertür. „Kann ich reinkommen?“, fragt eine Männerstimme.
„Meinetwegen.“ Was soll ich auch sonst sagen? Erwachsene machen eh, was sie wollen, egal, was du davon hältst.
Es ist der Pfarrer. Bestimmt hat seine Tochter ihn geholt, weil sie Angst vor dem Verrückten im Bad hat. Bestimmt ist er wütend, weil ich sie mit Sachen beworfen habe, aber sein Gesicht bleibt ganz ruhig. Er sieht sich in dem zertrümmerten Bad um, dann sieht er mich an.
Die Scherben knirschen unter seinen Sohlen, als er auf mich zukommt. Er trägt Schuhe. Mein Körper spannt sich. Da breitet er linkisch die Arme aus und ich kapiere, dass er mich hochheben will, mich über die Scherben hinwegtragen wie einen kleinen Jungen. Aus irgendeinem Grund tut das mehr weh, als wenn er mich geschlagen hätte.
Ich mache einen Schritt rückwärts, suche nach Worten und finde welche, mit denen ich ihn schlagen kann: „Nur weil dein Sohn tot ist … Ich brauch niemanden, der mich rettet, kapiert!“ Die Arme des Pfarrers sinken langsam herab, auch in seinem Gesicht sinkt etwas und ich schaue weg.
„Ich hab keinen Muskelschwund! Ich hab jede Menge Muskeln!“, sage ich, denn ich bin fast vierzehn.
Und dann laufe ich über die Scherben zur Tür. Ich merke, wie die Scherben in meine nackten Füße schneiden, aber ich laufe weiter.
Wolfgang Borchert
Das Brot (1946)
Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still, und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders still gemacht hatte: sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts. Um halb drei. In der Küche.
Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tuch. Und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hoch kroch. Und sie sah von dem Teller weg.
»Ich dachte, hier wäre was,« sagte er und sah in der Küche umher.
»Ich habe auch was gehört,« antwortete sie, und dabei fand sie, dass er nachts im Hemd doch schon recht alt aussah. So alt wie er war. Dreiundsechzig. Tagsüber sah er manchmal jünger aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er, im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt.
»Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest dich noch.«
Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass er log. Dass er log, nachdem sie neununddreißig Jahre verheiratet waren.
»Ich dachte, hier wäre was,« sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos von einer Ecke in die andere, »ich hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre was.«
»Ich habe auch was gehört. Aber es war wohl nichts.« Sie stellte den Teller vom Tisch und schnappte die Krümel von der Decke.
»Nein, es war wohl nichts,« echote er unsicher.
Sie kam ihm zu Hilfe: »Komm man. Das war wohl draußen. Komm man zu Bett. Du erkältest dich noch. Auf den kalten Fliesen.«
Er sah zum Fenster hin. »Ja, das muss wohl draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre hier.«
Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muss das Licht jetzt ausmachen, sonst muss ich nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller sehen. »Komm man,« sagte sie und machte das Licht aus, »das war wohl draußen. Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer.«
Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten Füße platschten auf den Fußboden.
»Wind ist ja,« meinte er. »Wind war schon die ganze Nacht.«
Als sie im Bett lagen, sagte sie: »Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne.«
Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne.« Er sagte das, als ob er schon halb im Schlaf wäre.
Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. »Es ist kalt,« sagte sie und gähnte leise, »ich krieche unter die Decke. Gute Nacht.«
»Nacht,« antwortete er und noch: »ja, kalt ist es schon ganz schön.«
Dann war es still. Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und vorsichtig kaute. Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, dass sie noch wach war. Aber sein Kauen war so regelmäßig, dass sie davon langsam einschlief.
Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. Sonst hatte er immer nur drei essen können.
»Du kannst ruhig vier essen,« sagte sie und ging von der Lampe weg. »Ich kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Iss du man eine mehr. Ich vertrage es nicht so gut.«
Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr leid.
»Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen,« sagte er auf seinen Teller.
»Doch. Abends vertrag ich das Brot nicht gut. Iss man. Iss man.«
Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch.
Wolfgang Borchert
Die Kirschen (1947)
Nebenan klirrte ein Glas. Jetzt isst er die Kirschen auf, die für mich sind dachte er. Dabei habe ich das Fieber. Sie hat die Kirschen extra vors Fenster gestellt, damit sie ganz kalt sind. Jetzt hat er das Glas hingeschmissen. Und ich hab das Fieber. Der Kranke stand auf. Er schob sich die Wand entlang. Dann sah er durch die Tür, dass sein Vater auf der Erde saß. Er hatte die ganze Hand voll Kirschsaft. Alles voll Kirschen, dachte der Kranke, alles voll. Kirschen. Dabei sollte ich sie essen. Ich hab doch das Fieber. Er hat die ganze. Hand voll Kirschsaft. Die waren sicher schön kalt. Sie hat sie doch extra vors Fenster gestellt Für das Fieber. Und er isst mir die ganzen Kirschen auf. Jetzt sitzt er auf der Erde und hat die ganze Hand davon voll. Und ich hab das Fieber. Und er hat den kalten Kirschsaft auf der Hand. Den schönen kalten Kirschsaft. Er war bestimmt ganz kalt. Er stand doch extra vorm Fenster. Für das Fieber. Er hielt sich am Türdrücker. Als der quietschte, sah der Vater auf. Junge, du musst doch zu Bett. Mit dem Fieber, Junge. Du musst sofort zu Bett. Alles voll Kirschen, flüsterte der Kranke. Er sah auf die Hand. Alles voll Kirschen.
Du musst sofort zu Bett, Junge. Der Vater versuchte aufzustehen und verzog das Gesicht. Es tropfte von seiner Hand. Alles Kirschen, flüsterte der Kranke. Alles meine Kirschen. Waren sie kalt? fragte er laut. Ja? Sie waren doch sicher schön kalt, wie? Sie hat sie doch extra vors Fenster gestellt, damit sie ganz kalt sind. Damit sie ganz kalt sind.
Der Vater sah ihn hilflos von unten an. Er lächelte etwas. Ich komme nicht wieder hoch, lächelte er und verzog das Gesicht. Das ist doch zu dumm, ich komme buchstäblich nicht wieder hoch. Der Kranke hielt sich an der Tür. Die bewegte sich leise hin und her von seinem Schwanken. Waren sie schön kalt? flüsterte er, ja? Ich bin nämlich hingefallen, sagte der Vater. Aber es ist wohl nur der Schreck. Ich bin ganz lahm, lächelte er. Das kommt von dem Schreck. Es geht gleich wieder. Dann bring ich dich zu Bett. Du musst ganz schnell zu Bett. Der Kranke sah auf die Hand
Ach, das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein kleiner Schnitt. Das hört gleich auf. Das kommt von der Tasse, winkte der Vater ab. Er sah hoch und verzog das Gesicht. Hoffentlich schimpft sie nicht. Sie mochte gerade diese Tasse so gern. Jetzt hab ich sie kaputt gemacht. Ausgerechnet diese Tasse, die sie so gern mochte. Ich wollte sie ausspülen, da bin ich ausgerutscht. Ich wollte sie nur ein bisschen kalt ausspülen und deine Kirschen da hinein tun. Aus dem Glas trinkt es sich so schlecht im Bett. Das weiß ich noch. Daraus trinkt es sich ganz schlecht im Bett. Der Kranke sah auf die Hand. Die Kirschen, flüsterte er, meine Kirschen? Der Vater versuchte noch einmal, hochzukommen. Die bring ich dir gleich, sagte er. Gleich, Junge. Geh schnell zu Bett mit deinem Fieber. Ich bring sie dir gleich. Sie stehen noch vorm Fenster, damit sie schön kalt sind. Ich bring sie dir sofort. Der Kranke schob sich an der Wand zurück zu seinem Bett. Als der Vater mit den Kirschen kam, hatte er den Kopf tief unter die Decke gesteckt.
Siegfried Lenz
Die Nacht im Hotel (1957)
Der Nachtportier strich mit seinen abgebissenen Fingerkuppen über eine Kladde, hob bedauernd die Schultern und drehte seinen Körper zur linken Seite, wobei sich der Stoff seiner Uniform gefährlich unter dem Arm spannte.
»Das ist die einzige Möglichkeit«, sagte er. »Zu so später Stunde werden Sie nirgendwo ein Einzelzimmer bekommen. Es steht Ihnen natürlich frei, in anderen Hotels nachzufragen. Aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, daß wir, wenn Sie ergebnislos zurückkommen, nicht mehr in der Lage sein werden, Ihnen zu dienen. Denn das freie Bett in dem Doppelzimmer, das Sie — ich weiß nicht aus welchen Gründen — nicht nehmen wollen, wird dann auch einen Müden gefunden haben.«
»Gut«, sagte Schwamm, »ich werde das Bett nehmen. Nur, wie Sie vielleicht verstehen werden, möchte ich wissen, mit wem ich das Zimmer zu teilen habe; nicht aus Vorsicht, gewiß nicht, denn ich habe nichts zu fürchten. Ist mein Partner — Leute, mit denen man eine Nacht verbringt, könnte man doch fast Partner nennen — schon da?«
»Er schläft«, wiederholte Schwamm, ließ sich die Anmeldeformulare geben, füllte sie aus und reichte sie dem Nachtportier zurück; dann ging er hinauf.
Unwillkürlich verlangsamte Schwamm, als er die Zimmertür mit der ihm genannten Zahl erblickte, seine Schritte, hielt den Atem an, in der Hoffnung, Geräusche, die der Fremde verursachen könnte, zu hören, und beugte sich dann zum Schlüsselloch hinab. Das Zimmer war dunkel. In diesem Augenblick hörte er jemanden die Treppe heraufkommen, und so tun, als ob er sich im Korridor geirrt habe. Eine andere Möglichkeit bestand darin, in das Zimmer zu treten, in welches er rechtmäßig eingewiesen worden war und in dessen einem Bett bereits ein Mann schlief.
Schwamm drückte die Klinke herab. Er schloß die Tür wieder und tastete mit flacher Hand nach dem Lichtschalter. Da hielt er plötzlich inne: neben ihm — und er schloß sofort, daß da die Betten stehen müßten — sagte jemand mit einer dunklen, aber auch energischen Stimme:
»Halt! Bitte machen Sie kein Licht. Sie würeden mir einen Gefallen tun, wenn Sie das Zimmer dunkel ließen.«
»Haben Sie auf mich gewartet?« fragte Schwamm erschrocken; doch er erhielt keine Antwort. Statt dessen sagte der Fremde:
»Stolpern Sie nicht über meine Krücken, und seien Sie vorsichtig, daß Sie nicht über meine Koffer fallen, der ungefähr in der Mitte des Zimmers steht. Ich werde Sie sicher zu Ihrem Bett dirigieren: Gehen Sie drei Schritte an der Wand entlang, und dann wenden Sie sich nach links, und wenn Sie wiederum drei Schritte getan haben, werden Sie den Bettpfosten berühren können.«
Schwamm gehorchte: er erreichte sein Bett, entkleidete sich und schlüpfte unter die Decke. Er hörte die Atemzüge des anderen und spürte, daß er vorerst nicht würde einschlafen können.
»Übrigens«, sagte er zögernd nach einer Weile, »mein Name ist Schwamm.«
»So«, sagte der andere.
»Ja.«
»Sind Sie zu einem Kongreß hierhergekommen?«
»Nein, und Sie?«
»Nein.«
»Geschäftlich?«
»Nein, das kann man nicht sagen.«
»Wahrscheinlich habe ich den merkwürdigsten Grund, den je ein Mensch hatte, um in die Stadt zu fahren«, sagte Schwamm. Auf dem nahen Bahnhof rangierte ein Zug. Die Erde zitterte, und die Betten, in denen die Männer lagen, vibrierten.
»Wollen Sie in der Stadt Selbstmord begehen?«, sagte der andere, »es ist dunkel.«
Schwamm erklärte mit banger Fröhlichkeit in der Stimme:
»Gott bewahre, nein. Ich habe einen Sohn, Herr … (der andere nannte nicht seinen Namen), einen kleinen Lausejungen, und seinetwegen bin ich hierhergefahren.«
»Ist er im Krankenhaus?«
»Wieso denn? Er ist gesund, ein wenig bleich zwar, das mag sein, aber sonst sehr gesund. Ich wollte Ihnen sagen, warum ich hier bin, hier bei Ihnen, in diesem Zimmer. Wie ich schon sagte, hängt das mit meinem Jungen zusammen. Er ist äußerst sensibel, mimosenhaft, er reagiert bereits, wenn ein Schatten auf ihn fällt.«
»Also ist er doch im Krankenhaus.«
»Nein«, rief Schwamm, »ich sagte schon, daß er gesund ist, in jeder Hinsicht. Aber er ist gefährdet, dieser kleine Bengel hat eine Glasseele, und darum ist er bedroht.«
»Warum begeht er nicht Selbstmord?« fragte der andere.
»Aber hören Sie, ein Kind wie er, ungereift, in solch einem Alter! Warum sagen Sie das? Nein, mein Junge ist aus folgendem Grunde gefährdet: Jeden Morgen, wenn er zur Schule geht — er geht übrigens immer allein dorthin — jeden Morgen muß er vor einer Schranke stehen bleiben und warten, bis der Frühzug vorbei ist. Er stand dann da, der kleine Kerl, und winkt, winkt heftig und freundlich und verzweifelt.«
»Ja und?«
»Dann«, sagte Schwamm, »dann geht er in die Schule, und wenn er nach Hause kommt, ist er verstört und benommen, und manchmal heult er auch. Er ist nicht imstande, seine Schularbeiten zu machen, er mag nicht spielen und nicht sprechen: das geht um schon seit Monaten so, jeden lieben Tag. Der Junge geht mir kaputt dabei.«
»Was veranlaßt ihn denn zu solchem Verhalten?«
»Sehen Sie,« sagte Schwamm, »das ist merkwürdig: Der Junge winkt, und –wie er traurig sieht –es winkt ihm keiner der Reisenden zurück. Und das nimmt er sich so zu Herzen, daß wir — meine Frau und ich — die größten Befürchtungen haben. Er winkt, und keine winkt zurück; man kann die Reisenden natürlich nicht dazu zwingen, und es wäre absurd und lächerlich, eine diesbezügliche Vorschrift zu erlassen, aber…«
»Und Sie, Herr Schwamm, wollen nun das Elend Ihres Jungen aufsaugen, indem Sie morgen den Frühzug nehmen, um dem Kleine zu winken?«
»Ja«, sagte Schwamm, »ja.«
»Mich«, sagte der Fremde, »gehen Kinder nichts an. Ich hasse sie und weiche ihnen aus, denn ihretwegen habe ich — wenn man’s genau nimmt — meine Frau verloren. Sie starb bei der Geburt.«
»Das tut mir leid,« sagte Schwamm und stützte sich im Bett auf. Eine angenehme Wärme floß durch seinen Körper; er spürte, daß er jetzt würde einschlafen können.
Der andere fragte: »Sie fahren nach Kurzbach, nicht wahr?«
»Ja.«
»Und Ihnen kommen keine Bedenken bei Ihrem Vorhaben? Offener gesagt: Sie schämen sich nicht, Ihren Jungen zu betrügen? Denn, was Sie vorhaben, Sie müssen es zugeben, ist doch ein glatter Betrug, eine Hintergehung.«
Schwamm sagte aufgebracht: »Was erlauben Sie sich, ich bitte Sie, wie kommen Sie dazu!« Er ließ sich fallen, zog die Decke über den Kopf, lag eine Weile übergehend da und schlief dann ein.
Als er am nächsten Morgen erwachte, stellte er fest, daß er allein im Zimmer war. Er blickte auf die Uhr und erschrak: bis zum Morgenzug bleiben ihm noch fünf Minuten, es war ausgeschlossen, daß er ihn noch erreichte.
Am Nachmittag – er konnte es sich nicht leisten, noch eine Nacht in der Stadt zu bleiben – kam er niedergeschlagen und enttäuscht zu Hause an.
Sein Junge öffnete ihm die Tür, glücklich, außer sich vor Freude. Er warf sich ihm entgegen und hämmerte mit den Fäusten gegen seinen Schenkel und rief:
»Einer hat gewinkt, einer hat ganz lange gewinkt.«
»Mit einer Krücke?«fragte Schwamm.
»Ja, mit einem Stock. Und zuletzt hat er sein Taschentuch an den Stock gebunden und es so lange aus dem Fenster gehalten, bis ich es nicht mehr sehen konnte.«
Botho Strauß
Rückkehr (2006)
Da gab es den Bäckermeister Alwin, der eines Morgens nicht mehr in seine Backstube kam, seine Frau Myriam verließ und nach Mexiko auswanderte. Dort kaufte er sich in eine Papierfabrik ein und wurde ein erfolgreicher Fabrikant. Schließlich gehörten ihm zwölf Papierfabriken in ganz Lateinamerika. Nach fünfundzwanzig Jahren kehrte er nach Hannover zurück. Dort lebte seine Frau immer noch in der kleinen Wohnung am Rande der Eilenriede. Sie war inzwischen fünfzig Jahre alt und litt eine bittere Armut. Als ihr Mann davon erfuhr, nahm er sich ein Herz und besuchte seine Frau in ihrer beider alten Bleibe. Die Frau saß bei einem Glas Pfirsichlikör an ihrem Tisch, an dem sie immer gesessen hatte, wenn die Küchenarbeit beendet war. Sie blickte auf, als ihr Mann plötzlich wieder neben ihr stand, und sah dann zurück auf die Tischplatte. Sie hörte, welch ein Angebot er ihr machte und welche Unterstützung er ihr versprach. Doch sie schüttelte den Kopf und bat ihn, sie wieder mit ihm allein zu lassen.
Monika Pelz
Eine Sucht
Ferdi Waldmüller, genannt Waldo (der Name ist aus Gründen der Anonymität geändert), war dafür berüchtigt, dass er Insekten ass, wenn man ihm Geld dafür gab. Man durfte dann zusehen, wie Waldo eine Fliege oder einen Käfer in den Mund steckte, zerbiss, zerkaute und hinunterschluckte. Bei kleinen Insekten kostete es weniger, bei grossen Brummern verlangte Waldo mehr für die Vorführung. Und immer fand sich einer, der zahlte. Um gratis in den Genuss dieses haarsträubenden Schauspiels zu kommen, machten wir für ihn Schlepperdienste und priesen ihn an: Du, ich kenne einen, der frisst den dicksten Käfer, wenn man ihm dafür fünfzig Schilling zahlt. Waldo überwand sich dazu nur, weil er ständig Geld brauchte. Von seinen Eltern bekam er nämlich keinen Schilling. Dass die Geldnot ihn zwang, etwas derart Ekliges zu tun, machte ihn beinahe zum Helden und Märtyrer. Keiner von uns anderen hätte das Zeug dazu gehabt. Kam Waldo dann mit irgendeiner neuen Erwerbung daher, einer Baseballmütze oder einer teuren Doppel-CD, so fingen wir unwillkürlich an nachzurechnen, wie viele Insekten er dafür wohl hatte hinunterwürgen müssen.
Ich vermute, die Kids heutzutage machen sich keinen Begriff davon, wie abartig uns Waldos Nummer vorkam. Heute gibt es ja Fliegen in den Lollis und Spinnen in der Limonade. Alles, was ich dazu sage, ist: Diese Fliegen und Spinnen sind mausetot, während Waldos Krabbeltiere noch lebten. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
Bis eines Tages die unerhörte Meldung kam und sich wie ein Lauffeuer verbreitete, dass Waldo von seinen Alten ausreichend Taschengeld kriegte und dass alles, was er darüber erzählte, erstunken und erlogen war. Dass er mit anderen Worten nicht den geringsten Grund hatte, sich zur Insektenfresserei zu zwingen. Sie schmeckten ihm, das war alles. Seine kleine Schwester hatte es ausgeplaudert: Selbst wenn Waldo allein war und garantiert keiner ihm zusah, geschweige denn bezahlte, frass er Käfer, kleine und grosse, gepunktete und grün schillernde. Er war in Wahrheit ganz süchtig nach ihnen. Unsere mit Grauen gemischte Bewunderung für Waldo erlosch schlagartig. Wir kamen uns total reingelegt vor. Über Nacht hatte Waldo sich vom Helden zum hinterhältigen Ekelmonster verwandelt. Später soll er übrigens ganz normal geworden sein und sich auf Gummibärlis, Kaugummis und Schokoriegel verlegt haben. Wir verloren ihn aus den Augen, weil seine Eltern in eine andere Stadt zogen. Dann kam diese Maturafeier. So ziemlich die Hälfte der Klasse war damals in Sissy Kratky verliebt, die andere Hälfte bestand aus uns Mädchen. Die Knaben standen andachtsvoll um Sissy herum und Sissy flirtete mit ihnen. Aus purer Freundlichkeit, wie ich wusste, denn in Wirklichkeit hielt sie alle für ziemlich kindisch. Und dann tauchte auf einmal ein Junge auf, der exakt so aussah wie Brad Pitt, nur hübscher, und naturgemäss waren auf einmal alle anderen Luft für Sissy Kratky. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und das sei, als ob der Blitz einschlüge. Sissy und der fremde Junge – ich hielt ihn übrigens aus irgendeinem Grund für den Sohn von Direktor Schillhammer – klebten förmlich aneinander. Sie lächelte geheimnisvoll, sie flüsterten, sie schwiegen. Es sah ganz so aus, als wollten sie den Rest des Lebens miteinander verbringen. Wie sie das so zusammen sassen und auch schon unauffällig Händchen hielten, verbreiteten sie eine Aura der Vollkommenheit und des Glücks, sodass man sich neben ihnen irgendwie ganz misslungen vorkam. Bis Professor Hirsch, unsere Zeichenlehrerin, den jungen Mann als Einzige wieder erkannte: „Du bist der Waldmüller!“
Aus war es und vorbei, Wer die alte Geschichte nicht kannte, dem wurde sie erzählt. Sissy schloss sich auf dem Klo ein und kam erst nach langem Zureden wieder heraus. Mit dem Ekelmonster Waldo wollte sie kein Wort mehr reden, nicht ein einziges klitzekleines Wort! Obwohl er angeblich schon seit Jahren keine Käfer mehr ass.
„Stellt euch vor“, pflegte Sissy schaudernd zu sagen, „ich hätte ihn damals schon beinahe geküsst!“
Nadja Einzmann
An manchen Tagen (2001)
An manchen Tagen warte ich, dass etwas passiert. Auf einen Anruf; dass das Haus einstürzt; oder der Arzt mir sagt, dass ich nur noch wenige Wochen zu leben habe. Ich sitze im Bett und warte, und meine Mutter klopft an die Türe. Zu berichten hat sie nichts. Sei so gut, sagt sie, bring den Müll hinunter, oder: Wie wäre es mit einem Spaziergang, es ist ein wunderbarer Tag, sonnig, und die Spatzen pfeifen es von allen Dächern. Nein, rufe ich ihr zu, durch die geschlossene Tür, mir ist nicht danach, mir ist nicht nach Welt. Und ich sitze im Bett, der Himmel schaut blau durch mein Fenster oder umwölkt sich, oder ein Gewitter zieht auf. Mein Bett ist mein Schiff, mein Bett ist mein Floß, ich treibe dahin, Haie und andere Meerestiere unter mir und Sterne und Himmel über mir. Was soll ich unternehmen mit dir, sagt meine Mutter, und stellt mir das Abendessen vor die Tür. Keines meiner Kinder, keines meiner Kinder, alle sind sie normal und gehen zur Arbeit, gehen morgens aus dem Haus und kehren abends zurück, nur du nicht. Was soll nur werden mit dir? Es gab Zeiten, da ich anders war, solche Zeiten hat es gegeben. Ausgesprochen lebhaft war ich. Keine Aufgabe war sicher vor mir, und dann noch zum bloßen Zeitvertreib zeichnete ich und voltigierte und focht und tanzte die Nächte durch. Meine Geschwister sahen müde aus, wenn sie von der Arbeit kamen. Sie hatten sich das Weiß in ihren Augen blutig gesehen über den Tag, und auch ihre Hände waren wund und schmerzten. Mir sah man keine Mühen an. Nie. Ich schwebte über den Boden, wo andere gingen, und dass ich mich bückte, kam nur sehr selten vor. Ja, es hat Zeiten gegeben, da ich anders war, und ich trauere ihnen nicht nach. Packt eure Herzen in Alufolie, dass sie geschützt sind, wenn ihr aus dem Haus geht, und reicht sie nicht frei herum! Es hat Zeiten gegeben, da ich anders war, und meine Mutter trauert ihnen nach. Kind, sagt sie, willst du nicht aufstehen, dass dein Vater mit dir fischen gehen kann und deine Geschwister dir berichten von ihrem Tag? Nein, sage ich, mir ist nicht nach Welt. In meinem Bett sitze ich, das mein Floß ist, und der Seegang ist hoch. Salziger Wind fährt mir durchs Haar und die Wellen überschlagen sich.
Lily Grün
Liebe (ca. 1937)
Einmal schrieb mir ein Mann: »– – ich will versuchen, all dies rasch zu vergessen. Das, was ich Deine Liebe nannte, Deine Treulosigkeit und Deine Feigheit. Wenn ich an Dich und an die Zeiten unseres Zusammenseins denke, fällt mir immer eine Seifenblase ein. Bunt schillernd, unendlich schön. Ich sah meine zärtlichsten, sü.esten Gedanken in ihr, alle meine Sehnsucht. Dann zerplatzte sie. Und was übrigblieb, war nichts. Gar nichts!« Ich lächelte, als ich diesen Brief las, und wollte nicht böse sein. Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. Warum sollte der Mann aus Kummer über seinen Verlust nicht seinen letzten Rest Verstand verlieren?
Einmal schrieb mir ein anderer Mann: »– – gnädige Frau, ich sah Sie gestern abend und hatte keine Gelegenheit, mich Ihnen zu nähern. Ich war wütend. Am liebsten hätte ich Sie ungeachtet aller Menschen, die um uns herumstanden, in meine Arme genommen und weit, weit weggetragen und Ihnen gesagt, daß ich Sie liebe, daß ich bezaubert, begeistert bin – – –.« Ich lächelte auch, als ich diesen Brief las. Gibt es nicht sogar im Gesetzbuch eine Klausel, die für Sinnesverwirrung mildernde Umstände vorschreibt?
Einmal sprach ich mit irgendeinem Mann. Er erzählte mir von anderen Frauen. Von Frauen, die ihn geliebt und die er verlassen, die er geliebt und die ihn verlassen. Ich hörte geduldig zu. Da sagte er von irgendeiner: »Wissen Sie, es war eine Frau wie Sie. Eine Frau, mit der man sehr glücklich ist, wenn man mit ihr beisammen ist, und wegen der man sich nicht erschießt, wenn sie uns verläßt …!« Diesen Mann habe ich zum Tode verurteilt.
Walter Benjamin
Das Karussell (1928)
Das Brett mit den dienstbaren Tieren rollte dicht überm Boden. Es hatte die Höhe, in der man am besten zu fliegen träumt. Musik setzte ein, und ruckweis rollte das Kind von seiner Mutter fort. Erst hatte es Angst, die Mutter zu verlassen. Dann aber merkte es, wie es selber treu war. Es thronte als treuer Herrscher über einer Welt, die ihm gehörte. In der Tangente bildeten Bäume und Eingeborene Spalier. Da tauchte, in einem Orient, wiederum die Mutter auf. Danach trat aus dem Urwald ein Wipfel, wie ihn das Kind schon vor Jahrtausenden, wie es ihn eben erst im Karussell gesehen hatte. Sein Tier war ihm zugetan: wie ein stummer Arion fuhr es auf seinem stummen Fisch dahin, ein hölzerner Stier-Zeus entführte es als makellose Europa. Längst war die ewige Wiederkehr aller Dinge Kinderweisheit geworden und das Leben ein uralter Rausch der Herrschaft mit dem dröhnenden Orchestrion in der Mitte. Spielte es langsamer, fing der Raum an zu stottern und die Bäume begannen sich zu besinnen. Das Karussell wurde unsicherer Grund. Und die Mutter stand da, der vielfach gerammte Pfahl, um den das landende Kind das Tau seiner Blicke warf.
Julia Franck
Streuselschnecke (2000)
Der Anruf kam, als ich vierzehn war. Ich wohnte seit einem Jahr nicht mehr bei meiner Mutter und meinen Schwestern, sondern bei Freunden in Berlin. Eine fremde Stimme meldete sich, der Mann nannte seinen Namen, sagte mir, er lebe in Berlin, und fragte, ob ich ihn kennen lernen wolle. Ich zögerte, ich war mir nicht sicher. Zwar hatte ich schon viel über solche Treffen gehört und mir oft vorgestellt, wie so etwas wäre, aber als es soweit war, empfand ich eher Unbehagen. Wir verabredeten uns.
Er trug Jeans, Jacke und Hose. Ich hatte mich geschminkt. Er führte mich ins Cafe Richter am Hindemithplatz, und wir gingen ins Kino, ein Film von Rohmer. Unsympathisch war er nicht, eher schüchtern. Er nahm mich mit ins Restaurant und stellte mich seinen Freunden vor. Ein feines, ironisches Lächeln zog er zwischen sich und die anderen Menschen. Ich ahnte, was das Lächeln verriet.
Einige Male durfte ich ihn bei seiner Arbeit besuchen. Er schrieb Drehbücher und führte Regie bei Filmen. Ich fragte mich, ob er mir Geld geben würde, wenn wir uns treffen, aber er gab mir keins, und ich traute mich nicht, danach zu fragen. Schlimm war das nicht, schließlich kannte ich ihn kaum, was sollte ich da schon verlangen? Außerdem konnte ich für mich selbst sorgen, ich ging zur Schule und putzen und arbeitete als Kindermädchen. Bald würde ich alt genug sein, um als Kellnerin zu arbeiten, und vielleicht wurde ja auch noch eines Tages etwas Richtiges aus mir.
Zwei Jahre später, der Mann und ich waren uns noch immer etwas fremd, sagte er mir, er sei krank. Er starb ein Jahr lang, ich besuchte ihn im Krankenhaus und fragte, was er sich wünsche. Er sagte mir, er habe Angst vor dem Tod und wolle es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Er fragte mich, ob ich ihm Morphium besorgen könne. Ich dachte nach, ich hatte einige Freunde, die Drogen nahmen, aber keinen, der sich mit Morphium auskannte. Auch war ich mir nicht sicher, ob die im Krankenhaus herausfinden wollten und würden, woher es kam. Ich vergaß seine Bitte.
Manchmal brachte ich ihm Blumen. Er fragte nach dem Morphium, und ich fragte ihn, ob er sich Kuchen wünsche, schließlich wusste ich, wie gerne er Torte aß. Er sagte, die einfachen Dinge seien ihm jetzt die liebsten - er wolle nur Streuselschnecken, nichts sonst. Ich ging nach Hause und buk Streuselschnecken, zwei Bleche voll. Sie waren noch warm, als ich sie ins Krankenhaus brachte. Er sagte, er hätte gerne mit mir gelebt, es zumindest gern versucht, er habe immer gedacht, dafür sei noch Zeit, eines Tages - aber jetzt sei es zu spät.
Kurz nach meinem siebzehnten Geburtstag war er tot. Meine kleine Schwester kam nach Berlin, wir gingen gemeinsam zur Beerdigung. Meine Mutter kam nicht. Ich nehme an, sie war mit anderem beschäftigt, außerdem hatte sie meinen Vater zu wenig gekannt und nicht geliebt.
Rafik Shami
Mehmet (1988)
Es war alles vorbereitet: Das Bier kaltgestellt, die Wurst- und Käseplatten hübsch mit Salzstangen und Zwiebelringen garniert – der Diaprojektor im Wohnzimmer schon seit Stunden aufgebaut, die Urlaubsbilder schon lange nach Reisestationen geordnet; es sollte ein gemütlicher Abend werden. Obwohl Heinz den Ablauf der Diashow schon x-mal geprobt hatte, war er sehr unsicher. Viertel nach acht war es soweit, die ersten Gäste kamen. Um neun Uhr hielt Heinz die Spannung nicht mehr aus, und er versuchte geschickt, auf seine Urlaubsdias aufmerksam zu machen – und wie das immer so ist, konnte er auch gleich beginnen. Das erste Bild zeigte die ganze Familie auf dem Frankfurter Flughafen, das zweite »über den Wolken« war auf den Kopf gestellt; Heinz entschuldigte sich sofort. Das dritte »Ankunft Flughafen Istanbul«, Tochter Ramona und Sohn Jens in Grossaufnahme. Die Gastgeberin erklärte, dass Ramona ausgerechnet heute bei einem Architekten eingeladen sei, sie liesse sich entschuldigen. Die weitere Reihenfolge der Bilder war wie bei jeder Urlaubsvorführung. Überbelichtet, angeblich lustige Szenen, die auch mit vielen Erklärungen die Gäste langweilten. Spannend waren allerdings die Erzählungen über die einfachen, gastfreundlichen Menschen … in der Türkei, die sie überall getroffen hatten. Müllers, die auch schon mal in der Türkei waren, konnten dies immer wieder bestätigen. Es war ein fast gelungener Abend. »Guten Abend«, sagte Ramona, »Entschuldigung, dass wir so spät kommen, aber ich musste noch auf Mehmet warten, sein Chef liess ihn mal wieder das ganze Lager alleine aufräumen.« Mehmet zog verlegen die Schultern hoch, lächelte und sagte: »Ich Chef sagen, heute ich Bilder von Türkei gucken, er nix wollen, er sagen, viel Arbeit, Bilder egal.« In dem halbdunklen Zimmer konnte niemand sehen, wie Heinz und seine Frau die Gesichtsfarbe wechselten und die Luft anhielten. Es herrschte eine grauenhafte Stille. »Aber du wolltest doch zu Herrn Schneider gehen, Ramona???«, sagte die Mutter. »Ich? Zu Herrn Schneider? – Ach ja, stimmt. Aber die Feier ist verschoben worden. Habe ich euch doch gesagt. Oder nicht???« Nun versuchten die Gäste die peinliche Situation zu überbrücken. »Das ist aber schön, dass du doch noch gekommen bist. Setz dich doch, Ramona.« Mehmet merkte sofort, dass er übersehen wurde, setzte sich aber trotzdem. Heinz versuchte sich zu beherrschen und ging in die Küche. Ganz plötzlich fiel Herrn Müller ein, dass die Kinder nicht zu Hause waren und der arme Hund bestimmt dringend raus musste; auch die anderen Gäste hatten plötzlich einen armen Hund und eine kranke Grossmutter. Ramona ahnte, was nun kommen würde, nahm den verdutzten Mehmet an die Hand, zog ihn zur Tür und sagte: »Bitte, bitte geh jetzt ganz schnell, ich werde dir morgen alles erklären.« »Was los? Warum morgen, nix heute??« Aus der Küche wurde die Stimme des Vaters immer lauter, verzweifelt drehte Ramona sich um und sagte ganz leise: »Bitte geh jetzt, bitte geh!« Nun könnte man diese Begebenheit unseres langweiligen Alltags mit einem traurigen Ende erwürgen, dann würde diese erbärmliche Geschichte so enden: Mehmet starrte wie betäubt die geschlossene Tür an. Obwohl es draussen warm war, durchlief ihn eine eisige Kälte, er zitterte am ganzen Körper. Anatolien war plötzlich ganz nah. In seinem Dorf hatten die Leute noch nie jemanden vor die Tür gesetzt. Oder, um dem Leser endlich meine Version zu erzählen: Mehmet geht hinaus, pinkelt durch den Briefkastenschlitz von Heinz’ Haustür, atmet erleichtert auf und beschliesst für sein Leben, nie eine Frau zur Freundin zu nehmen, die sich seiner schämt und mit ihm am ersten Abend Dias anschauen will.
Rahel Hollenstein
Gelb wie eine Zitrone (2013)
Feiner Dampf stieg aus der Kaffeetasse. Draussen war es noch dunkel und es schneite. Auf dem einzigen Stuhl am hölzernen Tisch sass ein alter Mann in einer blauen, abgenutzten Arbeitshose und einem wollenen grauen Pullover. Jeden Morgen vor seiner harten Arbeit im düsteren Bergwerk sass er in diesem von Neonleuchten grell beleuchteten Raum. Seine Arbeit im Bergwerk war eintönig und trostlos. Genau wie sein Leben. Sein Blick war bewegungslos auf das Ende des Raumes gerichtet. Dort befand sich eine Tür. Diese Tür war allerdings nicht wie normale Türen grau, braun oder schwarz. Nein, sie war gelb. Gelb wie eine Zitrone. Sie war einst von einem der Bergarbeiter aus Spass gelb angemalt worden. So interessant und vielversprechend diese Tür auch aussah, hinter ihr lag nur ein langer dunkler Gang, der tief in den Berg und die Trostlosigkeit hineinführte. Morgen für Morgen sass also der alte Mann auf diesem Stuhl und starrte die gelbe Tür an. Auch wenn er leider ganz genau wusste, was hinter dieser Tür war, regte ihn dieses Gelb Tag für Tag zum Denken an. Er stellte sich vor, was alles hinter einer so vielversprechenden Tür sein könnte. Er malte sich Geschichten von wunderschönen königlichen Gärten voller Blumen und Bäumen, orientalischen Basaren mit exotisch riechenden Gewürzen und Bergspitzen voller weissem Pulverschnee aus. Er dachte an viele kleine Fische im Meer und Blumen auf einer Bergwiese. Er dachte an alles Wunderbare und Interessante auf dieser Welt, was hinter einer so interessanten Tür liegen konnte. Er dachte daran, wie er aufstand, durch diese Tür schritt und in einer besseren Welt landete. In einer Welt, in der Gerechtigkeit und Frieden herrschten. In einer Welt, in der er nicht eine solch trostlose Arbeit verrichten musste. Diese wenigen Minuten am Morgen, waren die einzigen Minuten im Leben des Mannes, in denen er glücklich war. Mit dem siebten Schlag der Uhr, wurde der alte Mann aber jeweils wieder aus seinen Träumen gerissen und an seine Arbeit erinnert. Er stand auf, ging zur gelben Tür und trat in den kalten, langen und trostlosen Gang zum Bergwerk. Ein neuer Anfang eines harten Arbeitstages. So wie dieser winterliche Morgen vergingen schon hunderte andere Morgen zuvor, auf welche noch hunderte mehr folgten. Eines herbstlichen Morges im Oktober nahm alles ein Ende. Als der alte Mann wie gewohnt zum Kaffee kam, war die gelbe Tür verschwunden und der Mann blickte in den langen, dunklen und trostlosen Gang.
Lydia Dimitrow
Weg (2008)
Bis auf das Halstuch hatte sie alles mitgenommen. Es gab keinen Kafka mehr auf dem Nachttisch, keinen abgestandenen Kräutertee in der Küche. Sie hatte alles mitgenommen, bis auf das Halstuch, und vielleicht hing im Schlafzimmer auch noch der schwere Duft ihres Parfüms. Vielleicht war es aber auch nur seine Erinnerung. Er hatte die Wohnungstür aufgeschlossen und es gleich gewusst. Denn beim Reinkommen kein Jeff Buckley, kein Risotto. Und es war kälter als sonst. Alle Fenster offen, als wäre sie weggeflogen, nicht weggegangen. Das Bad war halbleer. Keine Parfümfläschchen mehr, kein Lockenstab, auch der Duschvorhang fehlte. Der blaue Duschvorhang mit den roten Herzen. Er hatte ihn nie gemocht. Die Schmuckschatulle stand nicht mehr unterm Spiegel. Es gab nur noch einen Kamm, keine Rundbürste mehr, weder klein noch groß, nicht mal mittel, einfach weg, nur Zahnbürste und Aftershave. Ein Shampoo für Männer. Damit die Haare nicht so schnell ausgehen. Im Flur fehlte der rote Ledermantel. Den kleinen Schuhschrank neben dem Schirmständer hatte sie einfach ganz mitgenommen.
Sie hatte die Bilder abgehängt. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Die Bücher mitgenommen. Die Küche einfach nur kalt. Und leer. Ohne Risotto und Kräutertee. Auch ohne Mikrowelle, aber das fiel ihm erst beim zweiten Mal auf. Er setzte sich hin und zählte die Videokassetten. Zwölf statt dreißig. Die CDs waren weg. Nur noch Metallica. Er saß da und suchte nach ihr. Aber da war nichts mehr. Nicht einmal die Holzgiraffe aus Kenia, die eigentlich ihm gehörte. Nur noch das Halstuch auf dem Sofa, das schwarze Halstuch, das sie nie gemocht hatte. Schließlich hatte er es ihr geschenkt. Er hörte, wie die Wohnungstür aufgeschlossen wurde. Er hörte die Schritte, das Zögern, dann öffnete sich die zweite Tür. Er stand nicht auf, er sah nicht auf. Er sagte: »Mama ist weg, Papa.«
Gunna Wendt
Tote Vögel
Als MajanachihremKonzertmitJulieimKlostergartenspazieren ging,drängtesichihrderGedankeauf, dassdie indenBäumen tagendenpechschwarzenKrähenverzauberteNonnenseinmussten, diedieseVerkleidunggewählthatten,umihrKlosterunbemerktzu verlassen.
UndwemdientederriesigeGreifvogelalsCamouflage,deran einemWintermorgendaslebhafteTreibenaufdemHinterhofin eisige Leereverwandelte?SiesaßeninJuliesKüchebeimFrühstückmitCornflakes,RosinenundMilch.JuliesBlickwurde immerunruhiger,so wiemanchmalinRestaurants,wennsie zur Türblickte,zunächstverstohlen,dannimmerhäufigerund unverhohlener,bisMajasichbewegungslosundohneLebenfühlte, berührtvoneinemZauberstab,dersie erstarrenundverstummen ließ.DerHinterhoferschrecktedurchseineStille.Gewöhnlich flattertendie VögelumherundstrittensichumdasfürsieausgehängteFutter.ManchmalmischtensichnochEichhörnchenin denStreitein, aberletztlichbekamjedergenugzufressenund genossdas Spiel,denvermeintlichenKampfumKörnerundNüsse.HeutewarderHofleerundlautlos.
MajaundJuliestandenvomFrühstückstischauf, simultan,und sahenaus demFenster.Wowarendie Tiere?PlötzlichwiesenJulies AugenhochindenBaum.Siehatteihnzuerstgesehen,denriesigen Greifvogel,deraufeinemAstsaßundmitirgendetwassehr beschäftigtwar.DerBlickdurcheinFernrohrverdeutlichte,waser tat:ErzerpflückteseineBeute,einenschönenVogelmit blauschimmerndemGefieder.ErblieblangeimHof,wechselteeinigeMaledenAst,vielleichtummehrzusehenoderumsich besserverborgenzuwissen.Allesbliebstillundleer,dieTiere bliebenverschwunden.
MajanahmJuliebeiderHandundführtesieinsArbeitszimmer.EinstrahlendblauerBildschirm,aufdemeinbunterKolibriherumflatterte,beleuchtetedenRaumundinspirierteMaja unwillkürlichzueinerOper.
Eswareinmaleinekleine Katze,die sichineinenKolibriverliebte. SietrafensichineinemWaldundliebtensich.DenanderenKatzen fielauf, dassdiekleineKatzeimmerzudemWaldstücklief, darinverschwand,vielvielspäterzurückkamundsehrsehrglücklichzuseinschien.BesondersargwöhnischbetrachtetederKater,derin diekleineKatzeverliebtwar,diesesTreiben.NungabeseineandereKatze,dieeswiederumaufdenKaterabgesehenhatte,und die derkleinenverliebtenKatzeaufihremWegindenWaldnachspionierte.Nachdemsiegesehenhatte,was dortvorsichging, liefsiezurück,umdemKaterdavonzuberichten.DerKaterwirdvonEifersuchtgepackt.Dumusstdirvorstellen,dassereinegroße Ariesingt,die damitendet,dasserdemRivalendenTodwünscht.
Mittlerweilebereutdie VerräterinihreTatundgestehtderkleinenKatzeihrenVerrat.AlsdiesezuihremnächstenRendezvousindenWaldläuft,wartenschondieHäscherdes KatersmitNetzen, um denRivalenzufangen.EsgibteinegroßeVerwirrung,dieFalle scheintzugeschnappt,die BeutewirdnachHausegetragen,woder KaterihrdenTodesstoßversetzt.Blutsickertaus demNetz.Esist Katzenblut,wiederentsetzteKatererkennt.NichtderRivalewurdegefangen,sonderndiegeliebtekleineKatze.Siesingtihre Todesarie.Meinstdu,die OpersollteanderMeturaufgeführt werdenoder lieberanderScala?
AufeinemSpaziergangstellteJuliedieFrage:Wosinddie toten Vögel?Majawarerstaunt,wusstekeineAntwort,undJulieschien dieFragesehrzubewegen.Siesprachüber dasSterbenderVögel, ihrganznormalesSterben,siemüssendochsterben,undwobleiben sie dann?
EinmalisteinVogelmitallseinerKraft undNeugiergegenMajas Fenstergeflogen.ErhatsichdenHalsgebrochen,siehatihnaufgehobenundineineSchachtelgelegt.DerMüllcontainerwar vollerTannenzweige,sieverbargdieSchachteldarin.AufdemZementbodenvorihremFensterwarnochlangedanacheine dunkelroteBlutspurzusehen.
Wildis Streng
Meinjulilein (2013)
»Guten Morgen, mein Julilein«, sagte er. Sie lächelte. Er sagte es jeden Morgen. »Guten Morgen, Herr Doktor Müller«, grüßte sie und blinzelte artig. Sie hasste es, wenn er sie Meinjulilein nannte. So hieß sie nicht. Sie hieß Julia. Julia Weber. Julia war ein schöner Name. Ein edler Name. Die Römerinnen hatten immer so geheißen. Edle Frauen. Stolze Frauen. Cäsar hatte seine Gattin bestimmt nicht Meinjulilein genannt. Wahrscheinlich hätte er auch seine Sekretärin nicht so genannt, wenn er eine gehabt hätte. Aber der Müller war eben nicht Cäsar. Nein, das war er ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Eigentlich ein dummer, ungebildeter Mensch. Mit genügend emotionaler Intelligenz, um bei der Nachkriegsgeneration zu schleimen und sich einen Chefsessel zu sichern. Emotionale Intelligenz. Das war etwas, was ihr fehlte. Das musste sie schon zugeben. Sie war eher der unkommunikative Typ. Zumindest bei Leuten, die sie nicht mochte. Die merkten das immer sofort. Aber sonst. Sonst war sie mehr als überqualifiziert für diesen Posten. Sekretärin. Pah. Naja. Besser als nichts, hatte ihre Mutter gesagt. Besser als arbeitslos sein, hatte ihr Vater gesagt. Weißt du, was das heutzutage bedeutet, arbeitslos sein? Und, ich hab dir ja gleich gesagt, dass das nichts bringt. Deutsch und Englisch auf Magister studieren. Wer macht denn sowas! Hättest eben BWL studieren sollen. Oder sonst was Brauchbares. Das haste jetzt davon. Sie lächelte dann immer. Immerhin. Der Müller hatte gegrinst, als er ihr Einser-Zeugnis gesehen hatte und gemeint, dann würde sie wenigstens keine Rechtschreibfehler machen. Dann hatte er sie noch gefragt, ob sie einen guten Kaffee kochen könne, und sie dann engagiert. Das war´s. Und seither arbeitete sie hier. Seit drei Jahren, vier Monaten und neunzehn Tagen. Und eigentlich war es ganz okay. Nett. Ja. Doch. Außer, dass er sie Meinjulilein nannte. Immer. Naja. Und ihr manchmal zärtlich den Hintern tätschelte. Sie hatte einen schönen Arsch, das wusste sie. Sie achtete sehr auf ihre Figur. Auf ihr Äußeres. Mens sana in corpore sano, sagte ihr Vater immer. Latein hatte er ja gehabt. So wie sie auch. Der Müller konnte kein Latein. Der konnte nicht mal ordentlich Englisch. Was heißt, wahrscheinlich konnte er durchschnittlich Englisch. Ein durchschnittlicher Mensch also. Er machte manchmal Fehler, verwechselte „for« und „since« und „become« und „get”. Außerdem hatte er einen wahnsinnig deutschen Akzent und schämte sich nicht einmal dafür. Sein Ti-Eitsch war ein schwächliches, unmotiviertes S. Peinlich war das. Sie hingegen. Sie hatte fünf Sprachen gelernt. Englisch, Latein, Französisch und Spanisch. Und etwas Italienisch im Urlaub. Als sie sich Florenz angeschaut hatte, hatte sie ein bisschen was gelernt. Florenz. Wunderschön war das gewesen. Die Kunst, die Kunst. Die alten Kirchen, die Gemälde. Die Glasfenster, die Skulpturen. Wunderschön. Sie hatte dem Müller davon erzählt, als sie zurückgekommen war. Nur, weil er gefragt hatte. Er hatte gelächelt und ihr zugehört. Dann hatte er genickt und „gut« gesagt. Und emotional intelligent gelächelt. Und sie dann nach einem Kaffee gefragt. Mit Milch ohne Zucker. Heute tätschelte er ihren Arsch nicht. Gottseidank. Sie hasste das. Sie hatte mal Linda erzählt, dass er das manchmal machte, und die hatte daraufhin entrüstet behauptet, das sei ja wohl sexuelle Belästigung und sie solle ihn anzeigen. Daraufhin hatte sie gelächelt und die Achseln gezuckt. Was machte das schon. Diese Hand auf ihrem Hintern für einige Sekunden. Es machte ihr nicht wirklich etwas aus. Und deswegen so ein Theater zu machen... nein. Das war es nicht wert. Außerdem brauchte sie den Job. Es war schwer, etwas zu finden. Hatte ihr Vater ja gleich gesagt. Und eigentlich war es ja ganz okay. Sowieso redete ihr Vater dauernd auf sie ein. Dass sie sich den Müller schnappen solle. Der sei Doktor der Betriebswirtschaft, schließlich. Ein Manager. Banker. Hatte womöglich Geld. Und sah doch nicht schlecht aus, der Kerl. Was willst du denn mehr, Mädchen!, hatte ihr Vater gerufen, als er den Müller einmal gesehen hatte. Schnapp ihn dir! Sie lächelte dann immer und versprach ihrem Vater, es zu versuchen. Vielleicht. Und sie hatte es versucht. Wirklich. Wegen der Vernunft. Weil sie ja schließlich mal heiraten sollte, irgendwann. Immerhin war sie schon vierunddreißigeinhalb. Aber es hatte nicht funktioniert. Sie hatte es versucht. Aber jedes Mal, wenn sie geglaubt hatte, dass sie es fast geschafft hatte, sich in ihn zu verlieben, ein bisschen wenigstens, hatte er sie wieder Meinjulilein genannt. Oder sonst einen Mist gebaut. Nun ja, er sah nicht schlecht aus, das musste sie zugeben. Und er stand sogar auf sie. Zumindest auf ihren Arsch. Einen leichten Bauchansatz hatte er, aber sonst war er relativ perfekt. Außerdem versteckte er seinen Bauch, indem er das Hemd nur locker in die Hose stopfte. Tadellos angezogen war er immer. Teure Anzüge. Passende Krawatten. Glänzend polierte Schuhe. Perfekt. Zu perfekt für ihren Geschmack. Klar fand sie schöne Männer gut. Zum Anschauen. Aber zu mehr nicht. Und der Müller war schön. Gerade, schmale Nase. Hohe Backenknochen. Dunkles Haar, das er mit Gel immer zu einer schwungvollen Welle frisierte. Volle Lippen. Hübsch, doch doch. Trotzdem. Er war ihr ... zu amerikanisch. Zu boygroupig irgendwie. Früher in der Schule war er bestimmt der Star gewesen. Sicher waren alle Mädels in ihn verknallt gewesen. Und die, die es nicht waren, wären trotzdem mit ihm gegangen, aus Prestigegründen. Weil er doch so dekorativ war. Und sicher war er gemein zu den Unsportlichen, Uncoolen. Sie gehörte damals zu den Strebern. Respektiert, aber unbeachtet. Nett, aber langweilig. Keinesfalls polarisierend. Ihren ersten Kuss hatte sie im Studium gekriegt. Von Wadim, einem polnischen Austauschstudenten, der sie unglaublich an den Grafen Strapinsky aus »Kleider machen Leute« erinnert hatte. Der Müller hasste Polen. Er nannte sie Polacken und machte Witze über sie. Er hasste überhaupt alle Ausländer außer den Amerikanern. Dabei war Wadim ein unglaublich sensibler Mensch gewesen. Die Amis hingegen verehrte der Müller geradezu. Seine Vorstellungen von den USA schwebten in himmlischen Sphären. Sie selbst fand die Amis blöd. Zu oberflächlich für ihren Geschmack. Aber das passte ja wiederum prima zum Müller. Denn oberflächlich war er ganz bestimmt. Der Müller war sogar schon einmal in Amerika gewesen. Auf irgendeinem Wirtschafts-Symposium in New York. Er schwärmte seit Jahren davon. Vor allem vom guten amerikanischen Kaffee, den ihm die Sekretärin dort gebracht hatte, die durchaus Ähnlichkeit mit ihr, dem Meinjulilein, gehabt hatte. Der war so gut gewesen, dass er gleich noch einen bestellt hatte, beim amerikanischen Meinjulilein. Den Hintern hatte er ihr wohl nicht getätschelt. In Amerika ginge sowas bestimmt nicht. Wie gesagt, nicht, dass es ihr groß was ausgemacht hätte. Aber in Amerika hätte er gleich eine Klage wegen sexueller Belästigung am Hals. Und da gab es ja die Todesstrafe, in Amerika. Nicht, dass sie ihm die Todesstrafe wünschen würde. Jetzt wegen der Hinternsache. Aber der Gedanke, dass er in einem dieser hässlichen grellorangenen Anzüge in irgendeiner Zelle schmoren würde, der hatte irgendwie was. Durchaus. Und vor dem Gefängnis stünden dann wütende, feministische Demonstrantinnen mit Transparenten und Schildern. Ach nein, das wäre zu gemein. Sie widmete sich ihrer Arbeit. Briefe zukleben. Sie leckte die gummierte Kante der Umschläge subtil ab. Das machte Spaß. Es war irgendwie verwegen. Nicht, dass sie den Müller hätte scharfmachen wollen. Sie machte es für sich. Weil es ihr Spaß machte, hier verwegen zu wirken. Der Müller lief vorbei und nickte ihr grinsend zu. Sein Blick blieb an ihrem kurzen Rock hängen. Dass sie verwegen Briefe zuklebte, bemerkte er gar nicht. Es war ihr egal. Sie leckte weiter Umschläge. Subtil. Dann klebte sie die Briefmarken auf. Es waren langweilige Briefmarken mit langweiligen Blumen drauf. Blauen, gefälligen Blumen. Und sie waren zum Abziehen und Aufkleben. Man brauchte sie also nicht abzulecken. Schade. Aber sie klebte die Marken sehr ordentlich auf. Genau einen Zentimeter vom Rand entfernt. Sie brauchte nicht nachzumessen. Das war jahrelange Erfahrung. Dann stapelte sie die Umschläge ordentlich in den Briefständer. Bündig. Sie wartete. Dann spitzte sie Bleistifte. Es waren drei Bleistifte der Härte HB. Handelsübliche Bleistifte. Sie hatte einen dieser elektrischen Spitzer auf dem Schreibtisch stehen, der die Stifte einfach immer weiter spitzte, solange man sie darin stecken ließ. Einmal war ihr so langweilig gewesen, dass sie einen ganzen Bleistift zerspitzt hatte. Die entstandenen Holzrosetten mit rotem Lackrand hatte sie dann auf dem Schreibtisch zunächst der Größe nach sortiert und dann zu einem ordentlichen Muster angeordnet. Sehr langweilig war ihr gewesen, an diesem Tag. Sie nahm einen der rot lackierten Bleistifte. Sie passten hervorragend zu ihren makellos lackierten Fingernägeln. Und sie glänzten edel. Sie waren perfekt scharf. Obwohl. Sie piekste sich in den Finger. Die Bleistiftspitze hinterließ einen gräulichen Abdruck. Kein Blut. Könnte schärfer sein. Sie steckte das Schreibgerät ins Spitzerloch. Sofort erkannte die Sensorautomatik den Bleistift, und er begann zu rotieren. Diesmal zerspitzte sie den Stift nicht, sondern nahm ihn nach wenigen Sekunden wieder heraus. Perfekt spitz. Sie wartete. Was wohl passieren würde, wenn man den Finger hineinstecken würde? Wie wohl ein gespitzter Finger aussähe? Wenn zum Beispiel der Müller sich lässig auf ihren Schreibtisch lehnen würde, so wie er es manchmal tat, und dann mit seinem Finger so ganz aus Versehen.... Das wäre ja schrecklich. Sie nahm die beiden anderen Bleistifte und spitzte sie genauso perfekt wie den ersten. Dann stellte sie fest, dass die Bleistifte unterschiedlich lang waren. Sie sortierte sie der Größe nach. Von der Tischkante ab bündig. Immer noch wartete sie. Sie wusste, dass es gleich passieren würde. Es war Punkt zehnuhrdreißig. Und tatsächlich. Die Sprechanlage ging an. »Meinjulilein, kommen Sie bitte mal?«, hörte sie die Stimme vom Müller. Sie erhob sich und ging in sein Büro. Zu seinem Mahagonischreibtisch, vor dem sie stehen blieb. Der Müller lümmelte in seinem ledernen Chefsessel und musterte sie anzüglich. Sie lächelte. »Ja?«, fragte sie. Es war eine unnötige Frage. Sie wusste ja, was er wollte. Schließlich war es zehnuhreinunddreißig. »Ach, machen Sie mir doch bitte eine Tasse Kaffee, mein Julilein«, sagte er. Sie nickte und wartete. »Und legen Sie einen dieser saftigen Kekse dazu, ja?«, fügte er noch hinzu. Das war ihr Stichwort. Wie jeden Morgen um zehnuhrdreiunddreißig. »Ja«, sagte sie und ging hinaus. Die Kaffeeküche war gleich nebenan. Das Büro hatte eine dieser kleinen, billigen Kaffeemaschinen, die für zwei oder drei Tassen völlig ausreichten. Der Kaffee, den man damit kochen konnte, war zwar nicht phänomenal, aber gut. Okay. Ausreichend. Sie öffnete die Kaffeemaschine. Es war noch die Filtertüte vom Vortag drin, mit dem dunkelbraunen, feuchten Kaffeepulver. Mit spitzen Fingern entfernte sie sie und warf sie weg. Dann öffnete sie den Schrank und zog eine frische Filtertüte aus der Schachtel. Sie spreizte sie mit ihren langen, feingliedrigen Fingern auseinander und legte sie in den Filter. Dann füllte sie Leitungswasser in den Entkalker. Der Müller bestand auf entkalktem Kaffeewasser. Es war zehnuhrfünfunddreißig. Wobei sie bezweifelte, dass man den Unterschied schmecken konnte. Obwohl. Man vielleicht schon. Aber er jedenfalls nicht. Sie hörte zu, wie das Wasser in einem dünnen, mickrigen Strahl durch das Gerät rieselte. Hörte sich irgendwie erbärmlich an. Dann nahm sie die Kaffeedose aus dem Schrank, die der Müller höchstpersönlich aus Amerika mitgebracht hatte. Mit einer drallen Pin-Up-Blondine drauf. Ein Gil-Elfgreen-Bild, aber das wusste er nicht. Sie füllte zweieinhalb Löffel Kaffeepulver in den Filter. Dann verschloss sie die Dose wieder und stellte sie zurück. Und sie füllte das Wasser aus dem Entkalker in die Maschine. Es plätscherte dürftig. Zuletzt schloss sie die weiße Plastikklappe und betätigte den Anschaltknopf. Er leuchtete in einem billigen Orangerot. Es war zehnuhrsiebenunddreißig. Sofort begann die Maschine, brodelnde Geräusche von sich zu geben. Aber nicht wie eine heiße Quelle oder so. Eher wie ein erkälteter Drache. Ein alter, bedauernswerter Drache. Schon bald bildete sich ein dünnes Rinnsal, das sich spärlich in die Kanne ergoss. Bräunlich. Jetzt, um zehnuhrneununddreißig, stellte sie die Tasse bereit. Sie war weiß und aus Porzellan. Handelsüblich. Genau wie die Untertasse. Das röchelnd-ersterbende Geräusch der Maschine verriet, dass der Kaffee durch war. Sie wartete noch einen Moment. Dann nahm sie die Kanne und schenkte den Kaffee ein. Und anschließend nahm sie das bereitstehende Milchkännchen und goss einen kleinen Schuss in den Kaffee. Sofort bildete sich ein hellbraunes Wölkchen. Perfekt. Es war jetzt zehnuhreinundvierzig. Sie lächelte zufrieden. Der Kaffee sah gut aus. Fehlte nur noch der Keks. Sie öffnete die Schranktür und holte die Packung mit den Keksen heraus. Mit den saftigen Keksen, die der Müller so gern mochte. Sie entnahm einen Keks. Er sah gut aus. Appetitlich. Und dann tat sie, was sie jeden Werktagmorgen um zehnuhreinundvierzig tat. Sie leckte den Keks ab und legte ihn auf die Untertasse.
Sibylle Berg
Nacht (2001)
Sie waren mit Tausenden aus unterschiedlichen Türen in den Abend geschoben. Es war eng auf den Straßen, zu viele Menschen müde und sich zu dicht, der Himmel war rosa. Die Menschen würden den Himmel ignorieren, den Abend und würden nach Hause gehen. Säßen dann auf der Couch, würden Gurken essen und mit einem kleinen Schmerz den Himmel ansehen, der vom Rosa ins Hellblaue wechseln würde, dann lila, bevor er unterginge. Eine Nacht wie geschaffen, alles hinter sich zu lassen, aber wofür? Sie funktionierten in dem, was ihnen Halt schien, die Menschen in der Stadt, und Halt kennt keine Pausen, Regeln, keine stille Zeit, in der Unbekanntes Raum hätte zu verunsichern mit dummen Fragen.
Das Mädchen und der Junge gingen nicht nach Hause. Sie waren jung, da hat man manchmal noch Mut. Etwas ganz Verrücktes müsste man heute tun, dachten beide unabhängig voneinander, doch das ist kein Wunder, denn bei so vielen Menschen auf der Welt kann es leicht vorkommen, dass sich Gedanken gleichen. Sie gingen auf einen Berg, der die Stadt beschützte. Dort stand ein hoher Aussichtsturm, bis zu den Alpen konnte man schauen und konnte ihnen Namen geben, den Alpen. Die hörten dann darauf, wenn man sie rief. Die beiden kannten sich nicht, wollten auch niemanden kennen in dieser Nacht, stiegen die 400 Stufen zum Aussichtsturm hinauf. Saßen an entgegengesetzten Enden, mürrisch zuerst, dass da noch einer war. So sind die Menschen, Revierverletzung nennt man das. Doch dann vergaßen sie die Anwesenheit und dachten in die Nacht. Vom Fliegen, vom Weggehen und Niemals-Zurückkommen handelten die Gedanken, und ohne dass es ihnen bewusst gewesen wäre, saßen sie bald nebeneinander und sagten die Gedanken laut.
Die Gedanken ähnelten sich, was nicht verwundert, bei so vielen Menschen auf der Welt, und doch ist es wie Schicksal, einen zu treffen, der spricht, was du gerade sagen möchtest. Und die Worte wurden weich, in der Nacht, klare Sätze wichen dem süßen Brei, den Verliebte aus ihren Mündern lassen, um sich darauf zum Schlafen zu legen. Sie hielten sich an der Hand, die ganze Nacht, und wussten nicht, was schöner war. Die Geräusche, die der Wind machte, die Tiere, die sangen, oder der Geruch des anderen. Dabei ist es so einfach, sagte der Junge, man muss nur ab und zu mal nicht nach Hause gehen, sondern in den Wald. Und das Mädchen sagte, wir werden es wieder vergessen, das ist das Schlimme. Alles vergisst man, das einem gut tut, und dann steigt man wieder in die Straßenbahn, morgens, geht ins Büro, nach Hause, fragt sich, wo das Leben bleibt. Und sie saßen immer noch, als der Morgen kam, als die Stadt zu atmen begann. Tausende aus ihren Häusern, die Autos geschäftig geputzt, und die beiden erkannten, dass es das Ende von ihnen wäre, hinunterzugehen ins Leben. Ich wollte, es gäbe nur noch uns, sagte der Junge. Das Mädchen nickte, sie dachte kurz: So soll das sein, und im gleichen Moment verschwand die Welt. Nur noch ein Aussichtsturm, ein Wald, ein paar Berge blieben auf einem kleinen Stern.
Sibylle Berg
Und in Arizona geht die Sonne auf (2000)
Der Asphaltcowboy mit Sporen an den Stiefeln: Nur im Auto ist der Mann noch ein Mann. Es ist zu früh zu hell, das Hemd scheuert an seinem Hals, die Krawatte würgt ihn. Er möchte sich kratzen, kratzen, kratzen, bis der Abend kommt. Der ist noch weit und er sitzt am Tisch. Er schubbert ein wenig sein Bein am Stuhl. Dass es nicht auffallen möge, sie ihn wieder ansehen, mit diesem Blick, der sagt: Was macht der Hund bei Tisch?
Seine Tochter redet über Kleider, seine Frau redet über Kleider, er kennt diese Personen nicht. Sie sehen ihn nicht. Er versteht nichts von wichtigen Dingen. Von Musik, Büchern, Blumen und von Kleidern, gar nichts. Sie geben ihm das Gefühl, etwas Störendes zu sein, zu laut, zu derb, nicht schön.
Er stört. Überall. Wenn er auf dem Sofa lümmelt und Bier trinken möchte, Sport schauen, stundenlang, ist er im Weg. Seine Bierflasche hinterlässt Ringe auf den Kunstbüchern, die auf dem Beistelltisch liegen. Seine Füße verschieben den Teppich, seine Chips krümeln, sein Atem macht schlechten Dunst. Scheißleben! Geduldet nimmt er sein Frühstück ein, es mag nicht recht rutschen in der trockenen Kehle. Was fühlst du, was denkst du, warum bist du so grob, warum fühlst du nichts, denkst du nichts? Nie genügt er. Nie mag seine Frau ihm glauben, dass er gar nichts denkt, nichts fühlt. Dass er glücklich ist, Sport zu schauen, zur Decke zu starren, in einer Kneipe zu hocken und mit anderen Männern zu schweigen. Endlich ist das Frühstück zu Ende, ein flüchtiger Kuss, Vater geht in die Welt, vielleicht kommt er nie zurück.
Er geht zu seinem Auto. Er steigt ein, nimmt Platz, das Auto begrüßt ihn: Hey, umziehen! Und endlich trägt er auch außen die Kleidung, die er innerlich immer anhat: speckige Jeans, Stiefel, Lederweste, Cowboyhut.
Die Sporen an den Stiefeln scheppern, er tritt das Gaspedal. Die Maschine arbeitet, sie gehorcht ihm. Sie bettelt um Beherrschung, will sich unterwerfen. Er steuert, er lenkt. Die starke Maschine, so viele Pferde, sie tragen ihn über die Prärie, den Ozean, ist doch egal. Endlich ist er wer. Ein einsamer Mann, der mit muskulösen Armen die Zügel hält. Seine Pferde reiten, schneller, besser als alle anderen. Keine greinenden Weiber, er und die Maschine, und in Arizona geht die Sonne auf. Freiheit, die ich meine, summt er und raucht in Gedanken eine fette Zigarre. Hier ist seine wahre Heimat. Vergessen mit jedem Kilometer die Weiber, die Kunstbücher, die Ringe vom Bierglas, das ist sein Wagen und wenn er da Bier reinstellt, ist es seine Sache. Da hat ihm keiner dreinzureden.
Yeah, sagt er leise, schießt den Gang rein, das Auto stöhnt dankbar. Die anderen Männer auf den schwächeren Pferden - abgehängt. Der letzte Kampf, den einer noch schlagen darf in einer Welt voller Schwuchteln und Frauen, die zetern und greinen: den Wagen mit ruhiger Hand zu Höchstleistungen treiben, vorantreiben, alle abhängen, besiegen, zeigen, wo der Hammer hängt. Unter seiner Hand wird das Auto ein Boot, ein Panzer, ein Formel-1-Geschoss - egal was, Hauptsache, Metall, Holz, Kolben, die Öl fressen und arbeiten wie ein Glied, wie ein Mann, verdammt, es ist so wenig, was er braucht. Den Hut, das Pferd und seine Ruhe. Warum gibt es das nur hier? Weil die Welt falsch geworden ist, weil keiner Respekt hat vor der Arbeit eines Mannes, weil sie ihn auslachen zu Hause, wenn er sich mit Kunstbüchern nicht auskennt.
Und er rast über die Stadtautobahn. Vor ihm die Sioux, hinter ihm Apachen. Ein größeres Auto wäre toll. Größeres Auto, größere Freiheit, größere Geschwindigkeit und Macht und weit weg damit und nie zurück. Nie zurück zu einer Familie, die ihn nicht versteht, zu Dingen, die ihn nichts angehen. Manchmal, wenn er sich selbst nicht sieht, möchte er weinen, so kotzt es ihn an, das Leben, das ihm einer heimlich in die Tasche gesteckt hat und das er verdammt nicht will. Er so kennt den Typ nicht, der im Anzug mit seiner Frau ins Theater geht. Seiner Frau, die mal so blond war, ihn bewundert hat. Lacht ihn aus inzwischen. War auch gar nicht blond. Gefärbt, betrogen, ausgelacht. Verdammt will er sein, ein anderes Leben haben, eines, das er sich als Junge immer vorgestellt hat. Er war ein Held gewesen in seinen Träumen. Und ist nun einer, der gelbe Haut hat und gelbe Finger vom Rauchen, vom Traurigsein. Das Auto umschließt ihn, ist ein Himmel für ihn allein, gibt ihm Halt in einer gottverdammten Welt, die aus den Fugen geraten ist. Rasen und kuppeln, das Chrom, das Leder, und dann beginnt er zu fliegen. Über die Straße, die anderen Wagen klein, die Straßen, die Luft unter dem Auspuff, fliegen, eine Runde drehen, da ist sein Haus, winzig klein, darin zwei Frauen, die er nicht versteht, in einem Leben, das er nicht verdient, in einer Welt, die nicht mehr gemacht ist für einen wie ihn. Er dreht ab, schräg über den Berg über die Prärie, da steht die Sonne und er lächelt. Zum ersten Mal an diesem Morgen.
Elisabeth Langgässer
Saisonbeginn (1947)
Die Arbeiter kamen mit ihrem Schild und einem hölzernen Pfosten, auf den es genagelt werden sollte, zu dem Eingang der Ortschaft, die hoch in den Bergen an der letzten Passkehre lag. Es war ein heißer Spätfrühlingstag, die Schneegrenze hatte sich schon hinauf zu den Gletscherwänden gezogen.
Überall standen die Wiesen wieder in Saft und Kraft; die Wucherblume verschwendete sich, der Löwenzahn strotzte und blähte sein Haupt über den milchigen Stengeln; Trollblumen, welche wie eingefettet mit gelber Sahne waren, platzten vor Glück, und in strahlenden Tümpeln kleinblütiger Enziane spiegelte sich ein Himmel von unwahrscheinlichem Blau. Auch die Häuser und Gasthöfe waren wie neu: ihre Fensterläden frisch angestrichen, die Schindeldächer gut ausgebessert , die Scherenzäune ergänzt. Ein Atemzug noch: dann würden die Fremden, die Sommergäste kommen die Lehrerinnen, die mutigen Sachsen, die Kinderreichen, die Alpinisten, aber vor allem die Autobesitzer in ihren großen Wagen…Ford und Mercedes, Fiat und Opel, blitzend von Chrom und Glas. Das Geld würde anrollen. Alles war darauf vorbereitet. Ein Schild kam zum anderen, die Haarnadelkurve zu dem
Totenkopf, Kilometerschilder und Schilder für Fußgänger: Zwei Minuten zum Café Alpenrose. An der Stelle, wo die Männer den Pfosten in die Erde einrammen wollten, stand ein Holzkreuz, über dem Kopf des Christus war auch ein Schild angebracht. Seine Inschrift war bis heute die gleiche, wie sie Pilatus entworfen hatte: J. N. R. J. , die Enttäuschung darüber, dass es im Grunde hätte heißen sollen: er behauptet nur, dieser König zu sein, hatte im Lauf der Jahrhunderte an Heftigkeit eingebüßt. Die beiden Männer, welche den Posten, das Schild und die große Schaufel, um den Pfosten in die Erde zu graben, auf ihren Schultern trugen, setzten alles unter dem Wegkreuz ab; der dritte stellte den Werkzeugkasten, Hammer, Zange und Nägel daneben und spuckte ermunternd aus.
Nun beratschlagten die drei Männer, an welcher Stelle die Inschrift des Schildes am besten zur Geltung käme; sie sollte für alle, welche das Dorf auf dem breiten Passweg betraten, besser: befuhren, als Blickfang dienen und nicht zu verfehlen sein. Man kam also überein, das Schild kurz vor dem Wegekreuz anzubringen, gewissermaßen als Gruß, den die Ortschaft jedem Fremden entgegenschickte. Leider stellt sich aber heraus, dass der Pfosten dann in den Pflasterbelag einer Tankstelle hätte gesetzt werden müssen, eine Sache, die sich selbst verbot, da die Wagen, besonders die größeren, dann am Wenden behindert waren. Die Männer schleppten also den Pfosten noch ein Stück weiter hinaus bis zu der Gemeindewiese und wollten schon mit der Arbeit beginnen, als ihnen auffiel, dass diese Stelle bereits zu weit von dem Ortsschild entfernt war, das den Namen angab und die Gemeinde, zu welcher der Flecken gehörte. Wenn also das Dorf den Vorzug dieses Schildes und seiner Inschrift für sich beanspruchen wollte, musste das Schild wieder näherrücken am besten gerade dem Kreuz gegenüber, so dass Wagen und Fußgänger zwischen beiden hätten passieren
müssen. Dieser Vorschlag, von dem Mann mit den Nägeln und dem Hammer gemacht, fand Beifall. Die beiden anderen luden von neuem den Pfosten auf ihre Schultern und schleppten ihn vor das Kreuz. Nun sollte also das Schild mit der Inschrift zu dem Wegekreuz senkrecht stehen; doch zeigte es sich, dass die uralte Buche, welche gerade hier ihre Äste mit riesiger Spanne nach beiden Seiten wie eine Mantelmadonna ihren Umhang entfaltete, die Inschrift im Sommer verdeckt und ihr Schattenspiel deren Bedeutung verwischt, aber mindestens abgeschwächt hätte. Es blieb daher nur noch die andere Seite neben dem Herrenkreuz, und da die erste, die in das Pflaster der Tankstelle überging, gewissermaßen den Platz des Schächers zur Linken bezeichnet hätte, wurde jetzt der Platz zur Rechten gewählt und endgültig beibehalten. Zwei Männer hoben die Erde aus, der dritte nagelte rasch das Schild mit wuchtigen Schlägen auf; dann stellten sie den Pfosten gemeinsam in die Grube und rammten ihn rings von allen Seiten mit größeren Feldsteinen an.
Ihre Tätigkeit blieb nicht unbeobachtet. Schulkinder machten sich gegenseitig die Ehre streitig, dabei zu helfen, den Hammer, die Nägel hinzureichen und passende Steine zu suchen; auch einige Frauen blieben stehen, um die Inschrift genau zu studieren. Zwei Nonnen, welche die Blumenvase zu Fuße des Kreuzes aufs neue füllten, blickten einander unsicher an, bevor sie weitergingen. Bei den Männern, die von der Holzarbeit oder vom Acker kamen, war die Wirkung verschieden: einige lachten, andere schüttelten nur den Kopf, ohne etwas zu sagen; die Mehrzahl blieb davon unberührt und gab weder Beifall noch Ablehnung kund, sondern war gleichgültig, wie sich die Sache auch immer entwickeln würde. Im Ganzen genommen konnten die Männer mit der Wirkung zufrieden sein. Der Pfosten, kerzengerade, trug das Schild mit der weithin sichtbaren Inschrift, die Nachmittagssonne glitt wie ein Finger über die zollgroßen Buchstaben hin und fuhr jeden einzelnen langsam nach wie den Richtspruch an einer Tafel. Auch der sterbende Christus, dessen blasses, blutüberronnenes Haupt im Tod nach der rechten Seite geneigt war, schien sich mit letzter Kraft zu bemühen, die Inschrift aufzunehmen: man merkte, sie ging ihn gleichfalls an, welcher bisher von den Leuten als einer der ihren betrachtet und wohl gelitten war. Unerbittlich und dauerhaft wie sein Leiden, würde sie ihm nun für lange Zeit schwarz auf weiß gegenüberstehen. Als die Männer den Kreuzigungsort verließen und ihr Handwerkszeug wieder zusammenpackten, blickten alle drei noch einmal befriedigt zu dem Schild mit der Inschrift auf. Sie lautete: »In diesem Kurort sind Juden unerwünscht.«
Wolf Wondratschek
43 Liebesgeschichten (1969)
Didi will immer. Olga ist bekannt dafür. Ursel hat schon dreimal Pech gehabt. Heidi macht keinen Hehl daraus.
Bei Elke weiß man nicht genau. Petra zögert. Barbara schweigt.
Andrea hat die Nase voll. Elisabeth rechnet nach. Eva sucht überall. Ute ist einfach zu kompliziert.
Gaby findet keinen. Sylvia findet es prima. Marianne bekommt Anfälle.
Nadine spricht davon. Edith weint dabei. Hannelore lacht darüber. Erika freut sich wie ein Kind. Bei Loni könnte man einen Hut dazwischenwerfen.
Katharina muss man dazu überreden. Ria ist sofort dabei. Brigitte ist tatsächlich eine Überraschung. Angela will nichts davon wissen.
Helga kann es.
Tanja hat Angst. Lisa nimmt alles tragisch. Bei Carola, Anke und Hanna hat es keinen Zweck.
Sabine wartet ab. Mit Ulla ist das so eine Sache. Ilse kann sich erstaunlich beherrschen.
Gretel denkt nicht daran. Vera denkt sich nichts dabei. Für Margot ist es bestimmt nicht einfach.
Christel weiß, was sie will. Camilla kann nicht drauf verzichten. Gundula übertreibt. Nina ziert sich noch. Ariane lehnt es einfach ab Alexandra ist eben Alexandra.
Vroni ist verrückt danach. Claudia hört auf ihre Eltern.
Didi will immer.
Linus Reichlin
Einseitig
Eine junge Frau erhängte sich in ihrer Zelle mit dem Kabel eines Tauchsieders, aber das ist eine einseitige Darstellung. Richtig ist, dass ihr Tee während des neunstündigen Dauerverhörs kalt geworden war und der Wärter ihr zum Aufwärmen den Tauchsieder überliess, an dessen Kabel die junge Frau sich erhängte, aber dies ist wiederum eine einseitige Darstellung. Richtig ist, dass die junge Frau keinen Tee mehr trinken wollte oder konnte, nachdem man sie durch gefälschte Briefe verunsichert, durch die fortgesetzte Nötigung, gegen ihren Freund auszusagen, geschwächt und zu guter Letzt durch den Ratschlag, sie solle sich doch aufhängen, dazu gebracht hatte, den Tauchsieder nicht zum Wärmen des Tees zu gebrauchen, sondern um sich daran aufzuhängen, am Kabel des Tauchsieders, den der Wärter ihr gab, aber das ist einseitig dargestellt. Richtig ist, dass er ihn ihr aus Mitleid gab. Dann war ihr aber nicht mehr ums Trinken zumute, auch des Briefs wegen nicht, in dem ihr Freund anonym der Untreue bezichtigt wurde und der, wie ein Journalist herausfand, von einem Verwandlungskünstler der Polizei gefälscht worden war, aber das ist die himmeltraurigste aller einseitigen Darstellungen. Richtig ist, dass der Journalist einseitiger Darstellungen wegen von seiner Zeitung entlassen wurde, und richtig ist ferner, dass die Wahrheit immer einseitig ist, selbst wenn man die Mörder auch zu Wort kommen lässt.
Thea Dorn
Vorsicht Steinschlag! (2011)
Der große Sassen, Gebieter über zwei Fernsehsender, eine Rundfunkanstalt und mehrere Verlagshäuser, war ein gewaltiger Mann. An diesem Abend saß er bei angenehm gedämpftem Licht und den verschwimmen-den Klängen eines Pianos in dem schweren schwarz-ledernen Sessel einer Hotelbar und schwitzte. Er versuchte, seinen mächtigen Körper aufrecht zu halten, während sich die Schweißtropfen an seinen Schläfen lösten und langsam am Hals hinunter in seinen Kragen rannen. Sein Kopf, der sonst Imperien lenkte, erschien ihm lächerlich weit vom Rumpf entfernt. Wie eine zufällig abgesprengte Felskugel thronte er auf dem Körpermassiv.
Sassens Gegenüber, eine junge Künstlerin namens Nona, modellierte, während sie sprach, mit ihren schmalen Händen die Luft. »Mein Material lebt, es atmet, es pulsiert, verstehen Sie? Ich versuche nicht, es zu manipulieren. Als Bildhauerin muss ich stets darauf lauschen, wohin mein Material will. Ich zwinge ihm nichts auf, ich bringe es nur dorthin, wohin es von selbst strebt.« Nonas nackte Ellbogen blitzten auf, als sie ihr langes dunkles Haar mit bei den Händen in den Nacken zurückwarf. Ihre glatten Achselhöhlen reflektierten das milde Barlicht. »Wenn ich mit einer Arbeit beginne, hat mein Material noch Angst. Es ist vorsichtig. Es kann nicht wissen, ob ich ihm Gewalt antue. Erst nach und nach öffnet es sich mir.«
Der große Sassen presste seinen Rücken tiefer in die Lehne des Sessels. Die Rinnsale, die unentwegt aus der Quelle über dem Ohr rieselten, stauten sich zwischen seinen Schulterblättern und färbten dunkle Seen auf den nachtblauen Anzug. Ein feines Frösteln ergriff ihn.
Das Stadium, wo er noch Worte mit Sinn verbinden konnte, hatte Sassen hinter sich gelassen. Die Stimme der Bildhauerin plätscherte über ihn hinweg. »Ich spüre die Impulse, die mein Material aussendet. Es wird erst dann ruhig, wenn es seine endgültige Gestalt gefunden hat. Jedes Ding hat eine ideale Form. In diesem Augenblick weiß ich: Mein Werk ist vollendet.«
Nona beendete ihre Rede mit einem knappen Lächeln und lehnte sich zurück, die Hände im Schoß gefaltet.
Sassens weiße, fleischige Finger hatten sich vom Körper losgemacht. Wie ein Quintett Nacktschnecken krochen sie über das lederne Armpolster des Sessels, feucht glänzende Spuren hinter sich lassend. »Nona, Sie sind eine außergewöhnliche Frau.« Sein Atem ging flach.
Nona schickte abermals ein kurzes Lächeln in ihr Gesicht. Darunter arbeitete sich das Cocktailkleid Zentimeter für Zentimeter an ihren Schenkeln empor. Für eine Sekunde stießen die Kanten von Rock und Strümpfen aneinander, lag tiefes Schwarz an transparentem Schwarz, dann schimmerte ein schmaler Streifen weißer Haut auf.
Sein Herz, sein Herz, ja, der große Sassen fühlte sein Herz. Etwas Unbekanntes schüttelte ihn, ein Grollen machte ihn schauern, brachte den Rotwein, den er soeben an den Mund geführt hatte, in Wallung, ließ ihn über den beengenden Glasrand hinausschwappen. Sassen spürte das Weiße in seinen Augen, ein Balken, ein weißer Balken brannte in seinen Pupillen. Verzerrte Bilder überschlugen sich in seinem Hirn, tanzten an der Innenwand seines Schädels den Tango mortale. Der Findlingskopf drohte aus seiner fragilen Lage herabzustürzen.
Nona erhob sich, und mit dem weißen Balken erlosch das Beben. » Kellner, einen Salzstreuer, bitte! Der Herr hat sich mit Rotwein befleckt.«
In Sassens Gesicht war es still geworden wie auf einer verödeten Leinwand. Einzig hinter den weit geöffneten Augen glomm eine machtlose Glut.
Es war ein Bild von ergreifender Schönheit, wie sich der große Sassen auf die Ewigkeit einrichtete. Die junge Bildhauerin zögerte einen Moment, bevor sie sich über ihn beugte. Mit geübten Fingern schloss sie die Lider im denkmälernen Antlitz. Die Signatur eines bedeutenden Lebens. Ihre Schritte entfernten sich lautlos über den dunklen Läufer. Und noch desselben Tages empfing eine respektvoll erschütterte Welt die Nachricht von Sassens Tode.
Jenny Erpenbeck
Haare (2001)
Im Bauch meiner Mutter sind mir lange schwarze Haare gewachsen, die zu Berge stehen, als ich auf die Welt komme. Es ist Frühling, und die Welt ist sehr hell. Ein schwarzes Haar nach dem andern kapituliert, fällt aus, fliegt davon, und überläßt blonden Geschwistern die Nachfolge auf meinem Kopf.
Als ich drei Jahre alt bin, steckt mein Vater mir noch Zöpfe aus Gras an, aber bald kann man meine Haare schon in zwei Büscheln zusammenfassen. Rechts und links über den Ohren stehen diese Büschel in einem Bogen von mir ab, wie Wasser, das aus einem Rohr kommt, entspringen sie einem Zopfhalter, der aussieht wie eine Kreuzung aus Margaritenblüte und Kronkorken. Bis ich fünf Jahre alt bin, werden meine Haare also gewaschen, gebürstet und gebüschelt, manchmal sogar schon geflochten. Warum es meiner Mutter ausgerechnet am Vorabend eines ersten Mai einfallen muß, sie kurz zu schneiden, weiß inzwischen niemand mehr. Heraus zum ersten Mai! Im Radio spielen sie Blasmusik. Den abgeschnittenen Zopf steckt meine Mutter zur Erinnerung in ein durchsichtiges Etui. Ich muß heraus zur Maidemonstration, aber zu Hause liegen fünfzehn Zentimeter von mir im gläsernen Sarg! An diesem Morgen defilieren Tausende an meinem kurzgeschorenen Kopf vorüber, sie zeigen mir ihre Zähne, sie lachen, nein, sie lachen mich aus, die ganze Stadt beugt sich über mich und streicht mir über den Kopf und lacht mich aus, selbst die Fahnen lachen, sie neigen sich über mich und lassen in einzigartiger Bosheit ihr langes rotes Haar in Wellen auf mich herabfallen.
Von diesem ersten Mai an will ich mindestens so dicke Zöpfe haben wie meine Cousine Heike. An deren Zöpfe kann sich rechts und links je ein Kind anhängen, dann dreht sie sich, und die Kinder fliegen. Meine Cousine Heike ist ein Karussell, ich will auch ein Karussell werden. Zu dieser Zeit sind die Haarbürsten mit den vielen einzelnen Borsten aus Plaste noch nicht erfunden, und einige Jahre später, als sie im Westen schon erfunden sind, erfahren wir nichts davon. Mit einem Kamm dauert das Auskämmen nach dem Haarewaschen zwei Stunden. Zwei Stunden sitze ich auf einem Hocker im Bad, ein Handtuch um die Schultern, und halte meiner Mutter den nassen Kopf hin, während diese ihre schwere Maischuld abbü.t, mein Haar in Strähnen unterteilt und Strähne für Strähne entfilzt. Einmal pro Woche geben wir uns auf diese Weise der Wiederherstellung der Pracht hin, zum Glück ist zu dieser Zeit die tägliche Haarwäsche noch nicht erfunden, und als sie im Westen schon erfunden ist, erfahren wir nichts davon. Während eines knappen Jahrzehnts gehören nun zwei blonde Zöpfe zu mir, die in Schlangenlinien in der Luft herumfliegen, wenn ich auf dem Schulweg renne, weil ich schon wieder zu spät bin. Mit deren Enden ich die Schallplatten abputzte, wenn ich den Lappen nicht finden kann. Aus denen ich im Sommer nach dem Baden das Wasser sauge. Ich knote die Zöpfe hinten ineinander, damit sie mir nicht über die frische Tinte wischen, klemme sie manchmal aus Versehen ein, wenn ich meine Tür zu schnell hinter mir zumache, und ich gehe mit diesen zwei Zöpfen zu meinem ersten Rendezvous. Der mir gefällt, trägt eine Lederjacke, die über und über mit Sicherheitsnadeln besteckt ist. Die Punks sind erfunden, aber ich habe nichts davon erfahren. Ich wickle mir die Quaste vom Zopf um den Zeigefinger und weiß nicht, was ich sagen soll. Der Punk ruft kein zweites Mal an, meine Haare geraten in Auflösung. Die Revolution auf meinen Kopf sieht nicht rot oder lila aus wie bei meinen Altersgenossinnen – mich emanzipiert sie zum Weihnachtsengel. Offene Haare! Was bisher Feiertagsfrisur war, erlaube ich mir jetzt für immer, natürlich muß ich nun selber kämmen. Und was bei Botticelli paradiesisch aussieht, verklemmt sich unter den Riemen meines Schulranzens, lädt sich elektrisch auf, wenn ich einen Pullover über den Kopf ziehe, verzwirbelt sich in unruhigen Nächten zu einem Filz. Für fünf selige Minuten im Fahrtwind hinten auf einem Moped reiße ich mir hinterher eine halbe Stunde am Schopf herum, und die ganz und gar unauflösbaren winzigen Knoten schneide ich schließlich nach klassischem Vorbild einfach ab. Einmal werde ich im Sommerurlaub ohnmächtig, als ich bei über dreißig Grad mit schiefem Kopf und einem wie der Hebel einer Maschine auf- und abfahrenden Arm an der allmorgendlichen Herrichtung meiner Frisur arbeite. Hin und wieder verwünsche ich diese Haare inbrünstig, aber so inbrünstig, wie man nur Dinge verwünscht, auf die man sich verlassen kann. Keinen Moment lang vergesse ich, daß meine Haare mein Schatz sind, in dem meine ganze Lebenszeit aufbewahrt ist, und bin geradezu besessen von der Idee, daß jemand sie mir im Schlaf abschneiden könnte. In blutigen Phantasien male ich mir aus, wie ich den Schändling martern würde.
Als ich sechzehn bin, verfängt sich der erste Mann in meinem Haar, und da, wie es scheint, haben die Fangschnüre ihren Zweck endlich erfüllt. Es wandelt mich eine Lust an, die ich bis dahin nicht kannte: diesen Flachs, der mir als Mädchen gewachsen ist, von mir zu trennen. Zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich zu einem Friseur, der Friseur schneidet über einen halben Meter ab, das Haar fällt zu Boden, der Friseur kehrt es zusammen und wirft es in den Mülleimer. Als ich mit meinem Freund in den Herbstferien nach Hiddensee übersetze, bläst mir der Wind um den Kopf. Es gibt aber nichts mehr, das sich verwirren könnte.
Anne Duden
Wimpertier (1995)
Fiedrig verfranstes Gold in hängenden Wassermassen. Endlich. Abends. Und ein bleiches, scharf gerändertes Blau unter dem einzigen, hingetuscht rosigen Lichtnebel. Lärm steigt aus den Härteschichten auf, ungedämpft, von hohler Kälte beflügelt, und das Gas verströmt sich und findet kein Ende.
Dies ist, von allen Momenten, immer noch der beste. Noch kann sie, einmal am Tag im Monat im Jahr auf- und durchatmen und sich selbst spüren lassen, daß an dem Rumpf mit seinem dickleibigen Großauge Arme und Beine sich befinden, die jetzt gerade leicht pendeln, bevor sie ein wenig ausschreiten und -greifen werden.
Zur Erinnerung.
Nein, mit der Dunkelheit im Rücken. Nein. Die Rippenheber mögen sich nicht mehr rühren. Einmal am Tag, wenn es hoch kommt. Und die Schwellkissen sind dünn und durchsichtig geworden, zwei schlecht vernähte, jetzt bei der kleinsten Bewegung aneinanderreibende Häute. Die Füllung ist ihnen ausgegangen, denn ich stoße mich zu oft, und alle fadenziehende Flüssigkeit, allen Gallert brauche ich für den einen entscheidenden Kampf, der früh morgens, oft noch in tiefster Dunkelheit, einsetzt und dann gewöhnlich, allerdings an Intensität abnehmend, den ganzen Tag andauert. Durch so dicht aufgehäufte Schleimschichten dringt natürlich kein Vogelgesang, nur schlieriges Licht, das, ehe es hier ankommt, schon durch sämtliche Lager- und Verbrauchszonen gejagt worden ist.
Mit der Dunkelheit im Rücken, bestimmt nicht. Und vollkommen aufgerieben in den Gelenken. Ständig zieht mir auch jemand die Haare einschließlich der Haar zwiebeln aus. Die meisten nachts. Aber meine Kopfkissen sammeln sie alle und hinterlegen sie mir. Unter dem Hortensienstrauch, der gerade jetzt, während der kältesten Jahreszeit, in voller Blüte steht, mußte ich kürzlich die wenigen mir wichtigen Toten wieder ausgraben. Es war eine leichte und trockene Arbeit. Denn es handelte sich jeweils nur um die drei entscheidenden menschlichen Innereien: Herz, Niere, Leber. Alles andere war nicht begraben worden. Und diese waren, eingewickelt in blaue Plastikfolie, gebündelt und verschnürt, nur oberflächlich im Torfmull eingebuddelt. Auf jeden Toten kam ein kopfgroßer, weißrosa Blütenball an dem unbelaubten Strauch. Ich stand in einem Verhältnis der Verantwortung zu ihnen, den Toten, aber schuldig war ich nicht.
Erst Holz gegen Holz, gerammt und geschlagen. Und Schreie von Wand zu Wand und vom Boden zur Decke und wieder zurück. Dann Schläge von Metall gegen Holz und Splittern, Spelzen und Reißen, trocken und ächzend, bis zu dem einen steil ansteigenden Schrei über die starr gewölbte Zunge in den jetzt geborstenen Raum. Die Zunge legt sich zurück auf den Mundboden und fließt, verebbt, sackt ab, versickert in Wimmern, Schluchzen und Verstummen. EINE FRAU WIRD BESEITIGT.
Das Mädchen lag auf dem Rücken, herausgeschnitten und abgetrennt, von der Dunkelheit umgeben, die nichts als ein Leitelement für Schlag, Schrei und Entfernen war. Die Tür wurde geöffnet und die Deckenbeleuchtung angeschaltet. Geht sie jetzt tot, fragte sie; ihr älterer Bruder im anderen Bett fragte nichts, aber hatte sich halb aufgerichtet und blickte haltlos umher wie plötzlich blind geworden. Nein, eure Mutter ist... sie braucht nur... nun schlaft schön weiter Es blieben einige Sekunden zwischen dem Gesagten und dem Abschalten des Lichts und Schließen der Tür.
Sie war aus einem tiefgelagerten Zusammenhang gekommen, gegen ihren Willen, aus einer belebten dunklen Ruhe. Sie wurde unaufhaltsam aufwärts getrieben, nach oben gezogen zu einem unvermeidlichen, unumgänglichen Ziel hin, bei dem sie ganz und gar nicht ankommen wollte. Ein Auftrieb entfernte sie von etwas, in das sie dringend gehörte, eine Schwebefauna und -flora, mit der alle Fasern Ihres Bindegewebes, alle Muskelstränge und Sehnen, alle Nervenenden verflochten waren. Hinterrücks war die Verankerung gekappt worden, durch ein plötzliches Geschehen von oben. Einen Anruf, einen Schrei. Vieles von ihr blieb unten hängen, ab- und ausgerissen, der ganze ihr mögliche Frieden, so daß sie rundum wund nun hochgezerrt wurde.
In allergrößter Nähe zum Tumult schon richtete sich ihr Wollen noch einmal auf das Entschwindende, auf die Behutsamkeit des Abgelagertseins. Aber sie ist schon an der Schwelle, sie wird schon über sie hinweggeschleift. Und noch ein letzter Schrei oder Schlag, das Öffnen der Tür oder schon das angehende Licht, und die Wahrheit bricht über ihren aufgebrachten, kleinen Körper herein. Ihr Körper, noch Momente zuvor ein nächtliches geschlossenes Auge, ein großes schlafendes Wimpertier, nun gewaltsam dazu gebracht, das Riesenlid, das ihn ganz bedeckte, zu heben, aufzuschlagen.
10 comments on “UNTERRICHT: Kurzgeschichten-Sammlung”
-
-
Sehr geehrter Herr Blume,
ich will mich zuallererst, für die grandiose Auswahl an Kurzgeschichten bedanken, die sie hier in gesammelter Form zusammengetragen haben. Mir ist aufgefallen, dass sie eigene Werke veröffentlicht haben, weswegen ich sie frage, ob ich, mit ihrer Erlaubnis und vorheriger Absprache, eigene Kurzgeschichten, der breiten Massen, auf dieser Seite, zur Schau stellen dürfte? Ich würde mich freuen, wenn sie mir in nähere Zukunft antworten könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Jannik F. -
Vielen Dank für die Auswahl an Kurzgeschichten. Manche davon sollte man idealerweise noch einmal Korrektur lesen. Beispielsweise in der Kurzgeschichte "Deutschstunde" wird zwischen den Zeiten hin und her gesprungen, teilweise auch mitten im Satz. Auch das/dass ist teilweise vertauscht.
-
Hallo, sehr gerne. Was die Konjunktionen angeht, muss ich mal drüber schauen. "Deutschstunde" ist von mir. So viel ich weiß, habe ich die Zeitsprünge damals bewusst eingebaut. Aber auch das kann ich mir nochmal anschauen. Liebe Grüße
-
Lustig, darüber habe ich mit meiner Kollegin gesprochen und mein Vorschlag war: Es handelt sich hierbei um ein sprachliches Mittel. Durch die Verwendung des Präsens wird unterstrichen, wie sich der unangenehme Moment bis ins Unendliche dehnt. Sobald Paul wieder aus dem Fokus des Lehrers herausfällt, geht die Geschichte im Präteritum weiter.
-
-
-
Hallo, hättet ihr zufällig Kenntnisse und Informationen zu Rahel Hollenstein (Gelb wie eine Zitrone)? Wir haben lange im Internet gesucht und wirklich gar nichts zu ihr gefunden. Wir bräuchten einige Informationen vom Autor und wo man diese Nachschlagen könnte.
FG
Taha-
Gleiches Problem... unauffiindbar; keine Publikationsdaten...
-
-
Wunderbare Kurzgeschichten, einige sind eher klassisch, viele finde ich sehr innovativ, für meinen DAF Unterricht in Buenos Aires, Argentinien
-
Das freut mich. Viele Grüße aus Deutschland!
-
-
[…] Größere Sammlung mit weiteren Kurzgeschichten […]
Schreibe einen Kommentar zu Jannik F. Antwort abbrechen