Aufklärung zielt auf ein Wissen, das uns zu Souveränen über unsere Handlungen macht. Ausgehend von diesem Verständnis meine ich hier einen wichtigen aufklärerischen Gedanken zu sehen, der lehrt, dass wir Digitalität zunächst nicht in Dingen, Netzwerken oder technisch-organisierte Umwelt suchen sollten, sondern reale Praktiken daraufhin überprüfen, inwieweit sie in die Kultur oder Welt digitalisierter Handlungsmuster passen.
Für mich ist die Pointierung in diesem Aufsatz hier wichtig, denn so wird trotz einer Diskussion, in der Digitalität leichthin als eine normativ gültige und erstrebenswerte Qualität von Unterrichtsorganisation propagiert wird, meines Erachtens zu Recht betont, dass wir einen Unterrichtsstil verfolgen sollten, der nur in dem Maße modern ist, wie er denjenigen gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht wird, die zur Akzeptanz und Verbreitung digitaler Verarbeitungsformen geführt haben. Konkret: Wenn kulturellen Manifestationen wie Texte oder Filmen Jugendlichen in der für sie als relevant empfundenen Umwelt als individualisierbar, bewertbar und transformierbar erscheinen, kann es sinnvoll sein (soll heißen: einen Lernvorteil bieten), eine solche Aneignungsform des Bewertens (Likens und Dislikens) ohne Kompetenznachweis zu einem Element von Unterricht zu machen. Oder um ein zweites Beispiel zu formulieren, es kann sich vorteilhaft erweisen, die Frage statt der These zum Ausgangspunkt des Unterrichts zu nehmen, weil Jugendliche appellative Mediensprache gewohnt sind. Genauso gut, kann es Gründe dafür geben, sich in der künstlich organisierten Lernumwelt der Schule gerade bestimmten Gewohnheit der Digitalität entgegenzusetzen. (Es wäre halt nur schön, wenn man dafür auch überzeugende Argumente formulieren könnte.) - Wichtig scheint mir, wie gesagt, der Fokus darauf, dass die digitale Mediensprache oder Form der digitalen Wirklichkeitsaneignung mit solchen Wahrnehmungs- und Handlungsmustern verknüpft ist, wie wir sie bei unseren Schülern und Schülerinnen vorfinden. Kultur findet in Köpfen, nicht Geräten statt; sie manifestiert sich dort nur.
Eher eine literarische kritische Note noch zum Abschluss in der Form einer Frage: Was bedeutet hier "beschreiben"? Bob, du verwendest diesen Ausdruck in deinen Ausführungen, die zu Stalder hinführen. Was meint hier beschreiben? Addiert eine Beschreibung lediglich Merkmale, die sich aus einer gleichsam wiederholten Wahrnehmung digitalisierter Kommunikationsformen als häufig auftretende Phänomene feststellen lassen? - Oder versammeln sich in einer Beschreibung Merkmale, die aus einer Funktionsanalyse der Digitalität resultieren? Kann Digitalität, wie sie sich in einer hochgradig funktional differenzierten Gesellschaft etabliert hat, nicht auf die Merkmale von Algorithmizität, Referentialität und Gemeinschaftlichkeit verzichten, weil sie sich aus strukturellen Zwängen ergeben würden oder handelt es sich um "zufällige" Eigenschaften eines kulturellen Trends?
DISKUSSION: Kultur der Digitalität - eine kritische Betrachtung
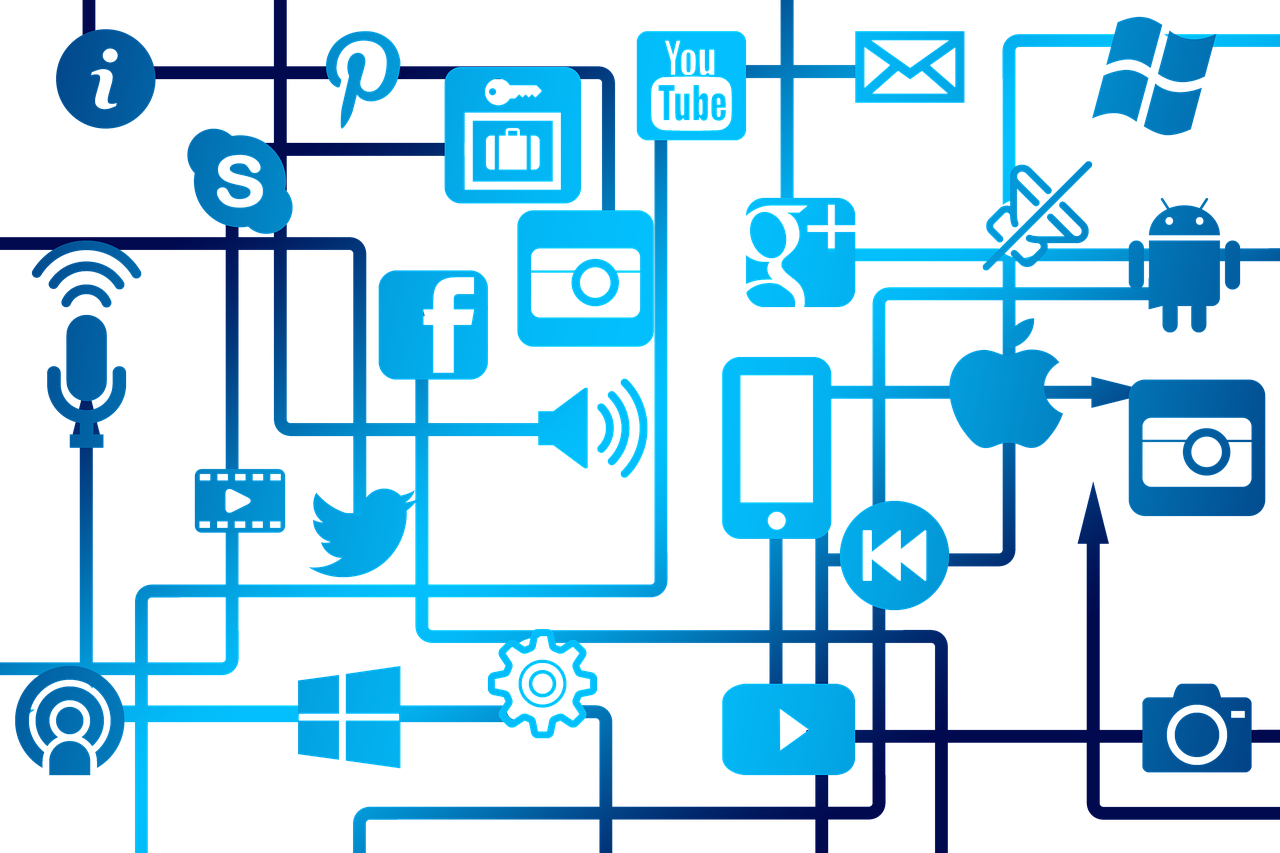
Der Begriff "Kultur der Digitalität" aus dem gleichnamigen Buch von Felix Stalder bietet nützliche Kategorien für das Verständnis der von Digitalität bedingten und geprägten Kultur, obwohl oder womöglich sogar weil letzterer Begriff sehr unscharf formuliert wurde. Obwohl sich daraus Handlungsanweisungen ableiten lassen, bietet er zunächst einmal Kategorien für die Beschreibung von "Eigenschaften der neuen Kultur", wie Stalder sie selbst nennt. Durch seine Vagheit und die Vermischung von Beschreibungskategorien und Handlungsanweisungen lässt sich der Begriff aber auch normativ und exklusiv fassen und dient damit als Ausschlusskriterium für Diskursteilnehmer*innen. Eine kritische Betrachtung.
Fragestellung
Die von Stalder vorgeschlagenen Prinzipien sind nützlich, um Prozesse des Digitalen zu beschreiben. So ist es von Stalder auch explizit intendiert. Denn obwohl im letzten Kapitel des gleichnamigen Buches über die "Kultur der Digitalität" die plattformorientierte "Postdemokratie" den an Partizipation orientierten "Commons" gegenübergestellt wird (vgl. u.a. S.205) bestehen die ersten beiden Kapitel aus der Vorstellung von 1) der Genese und 2) der Ausprägung der sogenannten "Kultur der Digitalität". Sowohl aus der Herleitung als auch aus der Beschreibung kann ein fruchtbares Verständnis gebildet werden. Und auch das daraus abgeleitete Plädoyer nach neuen Organisationsformen ist durchaus ansprechend und nachvollziehbar.
Nicht sinnvoll, sondern sogar problematisch und toxisch ist das reduzierte Verständnis des Begriffs
Nicht sinnvoll, sondern sogar problematisch und toxisch ist das reduzierte Verständnis des Begriffs, wie es immer wieder in digitalen Formaten weiterverbreitet wird. Dies liegt unter anderem auch daran, dass die Bedingungen der Kultur der Digitalität mit zu erreichenden Zielen des schulischen Lernens gleichgesetzt werden. Im oberflächlichen Verständnis wird die Kultur der Digitalität dann zu einer Folie für die aktivistische Abwertung von Unterrichtszusammenhängen, die kontextlos abgeurteilt werden. Die Fragestellung, die sich hieraus ergibt, ist jene nach Verwendung und Kontext der Begrifflichkeit.
Aus dieser ergibt sich bei näherer Betrachtung eine Kritik, die nicht die Begrifflichkeit selbst, sondern ihre Verengung und Normierung anprangert.
Warum es Begriffe braucht
Es ist einleuchtend, warum man in Gesprächen über Begriffe in Bezug auf Digitalisierung oftmals hört, dass diese bloßes Geschwafel ohne Kern seien, die sich nicht auf den konkreten Unterrichtsalltag beziehen lassen. Dennoch geht eine solche Kritik an den Funktionen von Begriffen vorbei: Diese bieten eine Grundlage für die Gestaltung dessen, was dann im Konkreten auf sie verzichten kann.
Gerade in Bezug auf die Digitalisierung ist dies wichtig, da der bloße Prozess der Übertragung vom Analoge ins Digitale noch keinen Wandel bedeutet (was im Übrigen die konservative Forderung nach abgeschlossenen Systemen, mit denen man das bestehende schulische Lernen übertragen kann, legitim macht, selbst wenn man nicht zustimmt). Begriffe bilden also das Fundament für eine Diskussion, die sich auf diese beziehen, von ihnen abgrenzen und auf ihnen aufbauen kann. Aus diesem Grund sind sie nützlich, ja sogar unverzichtbar.
Die Kultur der Digitalität beschreibt zunächst einmal die Veränderung von Bedeutungsgestaltung. "Als Kultur werden im Folgenden all jene Prozesse bezeichnet, in denen soziale Bedeutung, also die normative Dimension der Existenz, durch singuläre und kollektive Handlungen explizit oder implizit verhandelt und realisiert wird."
Die Kultur der Digitalität beschreibt zunächst einmal die Veränderung von Bedeutungsgestaltung
Die Kultur der Digitalität ist bei Stalder die "Vervielfältigung der kulturellen Möglichkeiten". Diese geschehen auch durch die Digitalität, die mehr ist als die Vernetzung von Computern. "'Digitalität' bezeichnet (...) jenes Set von Relationen, das heute auf Basis der Infrastruktur digitaler Netzwerke in Produktion, Nutzung und Transformation materieller und immaterieller Güter sowie in der Konstitution und Koordination persönlichen und kollektiven Handels realisiert wird."
Das ist bei Stalder alles, was für seinen Kulturbegriff wichtig ist, wie er sagt. Führt man sich Lisa Rosas Kulturverstädnis nochmals vor Augen, zeigt sich das Defizit. Bei ihr ist Kultur "das Bündel, die Gesamtheit der Gegenstände bzw. Artefakte (materiell, physisch wie ideell, geistig), die zu dem jeweiligen „Betriebssystem“ gehören, vermittels dessen sich die Menschen (bzw. Menschheit) zu einer gegebenen Zeit (historisch) an einem bestimmten Ort (räumlich) ihre notwendige Gesellschaftlichkeit organisieren.“
Auch wenn in dieser Definition "Gesellschaftlichkeit" an Stalders "Gemeinschaftlichkeit" erinnern lässt, zeigt sich Stalders Verkürzung in dessen ausschließlichen Blick auf das Ideelle der Kultur, das nicht umsonst dem Institutionellen entgegengestellt wird. Das macht das eigentliche Grundthema, die Verhandlung von sozialer Bedeutung in kulturellen Prozessen, nicht weniger wichtig, zeigt aber die Grenze dieses Verständnisses. Eine weitere Grenze ergibt sich in dem, was Stalder als Gemeinschaftlichkeit überhaupt in den Blick nimmt. Dennoch: Die Aufnahme des Begriffes, der eigentlich eine kulturwissenschaftliche Perspektive einnimmt, in den Bildungsdiskurs, ist durchaus sinnvoll.
Denn hier beschreibt er - eben auch im Rahmen der Verhandlung von sozialer Bedeutung - Lernen und Bildung in einer Gesellschaft, in der das Digitale bzw. die Digitalität zunehmend wichtig wird.
"Begriffe fungieren oftmals als Leitlinien oder Rahmen, innerhalb oder außerhalb derer man sich bewegt"
Der Begriff kann als - zugegeben abstrakte - Leitlinie oder Rahmen dienen, innerhalb oder außerhalb derer man sich bewegt. Der Begriff "Kultur der Digitalität" kann so als ein Gegenstück zur "Digitalisierung" gesehen werden, da er eben von mehr ausgeht als vom Prozess der Umformung, eine "Computerisierung" oder eine "Technisierung" bestehender Strukturen. In einem aktuellen Video bringt Jöran Muuß-Merholz den Unterschied auf den Punkt: Es gehe nicht darum, was die Digitalisierung mit der Bildung macht, sondern darum, was die Bildung mit der Digitalisierung macht.
Eine Bildung, die die Kultur der Digitalität im Blick hat, ist also etwas anderes als eine Bildung, die die Digitalisierung im Blick hat.
Dass die Einbindung von digitaler Technik auf auf das Gegenteil von offener Bildung hinauslaufen kann, ist keine leere Angst. Nach Nassehi könnte man sagen, dass das Digitale innerhalb von Systemen hier anschlussfähig wird. Genau dies wird ja auch angeprangert, wenn bestimmte digitale Anwendungen suggerieren, das Problem des Lernens lösen zu können. In Wirklichkeit verengen sie den Handlungsrahmen, indem sie eine Vorstrukturierung vornehmen, die wenig Raum für tatsächliche Kreativität lässt.
Schüler*innen umgehen dies natürlich auch, indem sie Anwendungen nicht so nutzen, wie sie vorgesehen waren und damit eine produktive Neubewertung vornehmen (auch das ein Charakteristikum einer im folgenden definierten "Kultur der Digitalität").
Was der Begriff der "Kultur der Digitalität" bedeutet
Die Bedingungen, oder wie er es nennt, die "allgemein verbreitete[n], spezifische[n] Formen der Kultur der Digitalität", sind nach Stalder Algorithmizität, Referentialität und Gemeinschaftlichkeit, die miteinander in einem komplexen Gefüge stehen.
"Referentialität, also die Nutzung bestehenden kulturellen Materials für die eigene Produktion (...), mit denen sich Menschen in kulturelle Prozesse einschreiben." Gemeinschaftlichkeit als "kollektiv getragene[r] Referenzrahmen, in dem "Bedeutungen stabilisiert, Handlungsoptionen generiert und Ressourcen zugänglich gemacht werden". Und Algorithmizität, "(...)geprägt durch automatisierte Entscheidungsverfahren, die den Informationsüberschuss reduzieren und formen, so dass sich aus den von Maschinen produzierten Datenmengen Informationen gewinnen lassen."
An dieser Stelle bietet sich ein Beispiel an: Wenn innerhalb von Social-Media-Netzwerk über die Frage gestritten wird, ob eine bestimmte Aussage (z.B eines Politikers) richtig oder falsch ist (auch das nach Stalder wichtige Fragen für eine pragmatische Sicht auf Kultur), dann werden die Beteiligten innerhalb ihrer Filterblase (also innerhalb der Gemeinschaftlichkeit) Aussagen tätigen, die sich auf diese (vielleicht kontroverse) Aussage beziehen (Referentialität) und die durch soziale Interaktionen wie Kommentaren oder Hashtags für andere sichtbar gemacht werden (Algorithmizität).
"Digitalität ist nicht Auslöser, sondern Katalysator schon zuvor bestehender Prozesse"
Dabei ist jeder Teil dieser "Kultur der Digitalität" einem Aushandlungsprozess unterworfen, sogar die Frage danach, wer Teil der Gemeinschaftlichkeit ist, die sich ja erst durch gemeinsame Referenzen konstituiert. Der Aushandlungsprozess bestimmt so auch darüber, wer überhaupt als Teil des Prozesses gesehen werden kann. Dies wird allerdings, anders als innerhalb von starren Institutionen, nicht von bürokratischen Mechanismen bestimmt, sondern kann eben auch informell passieren. Aus diesem Charakteristikum wird konsequenter Weise oftmals die Beteiligung informeller Netzwerke an bestehenden institutionellen Prozessen abgeleitet.
Auch hierzu ein Beispiel: Wenn ich Teil der universitären Gemeinschaft sein möchte, brauche ich dafür ein Zertifikat (das Abitur), das mir eine Einschreibung in ein Fachgebiet erlaubt, in dem ich Expertise erlangen kann.
Wenn ich Teil eines bestimmten digitalen Netzwerks sein kann, geschieht dies durch die Nutzung eines Hashtags, anhand von Aussagen oder Anhand einer Expertise, die unabhängig von der Person gesehen werden kann (wie es beispielsweise bei Reddit der Fall ist).
Grundsätzlich muss man dazu zwei wichtige Dinge konstatieren: Zum einen hat für Stalder die Digitalität und damit die neue Bedingung die Aushandlungsprozesse nicht Auslöser, sondern Katalysator schon zuvor bestehender Prozesse (und bei weitem keine normative Zielsetzung). Will sagen: In seinem Buch sind es Randgruppen der pluralen Gesellschaft wie die Schwulenbewegung, die schon vor dem Internet in der Bewegung zu neuem Selbstbewusstsein kam. Die Bedingungen der Digitalität haben diesen Prozess beschleunigt. Die Digitalität ergibt durch ihre Durchlässigkeit Sichtbarkeit und Transparenz, Geschwindigkeit und eben Offenheit.
"Es gibt keine gute Kultur der Digitalität"
Zum anderen, und das wird schon in dieser Sicht auf die Kultur der Digitalität vergessen, sind diese Prozesse natürlich allgemein gültig. Es gibt keine gute Kultur der Digitalität, auch wenn Stalder aus den Bedingungen eine Handlungsanweisung ableitet. Das heißt: Natürlich kann man aus der Beschreibung von Prozessen moralische Urteile ableiten, die dann eine Entwicklung positiv sieht. Das Urteil (in dem Sinne, dass man die Sichtbarmachung von vormaligen Randgruppen als wichtigen Schritt einer pluralen Gesellschaft sieht) ist aber erst der zweite Schritt.
Denn auch innerhalb von rechten Foren, Meme-Gruppen und in toxischen Gesprächen und Angriffen von Rechten auf Social-Media sieht man die Wirkung der Kultur der Digitalität. Im Grunde genommen machen Stalders Begriffe jeden Shitstorm erklärbar. Das ist wichtig, da es zeigt, dass der Begriff (sofern er und seine Implikationen wahr sind) nicht normativ ist, sondern eine Praxis beschreibt, der zunächst keiner ethischen oder moralischen Bewertung zu Grunde liegt. Dass Stalder die Frauen- und Schwulenbewegung als Beispiele nimmt, zeugt natürlich von seiner liberalen Einstellung. Genauso gut hätte man aber das Erstarken der neuen Rechten als Beleg einer funktionierenden Kultur der Digitalität anführen können.
"It was amid this ironical in-jokey maze of meaning that the online culture wars played out, that Trump got elected and that what we now call the alt-right came to prominence" ("Inmitten dieses ironischen Bedeutungslabyrinths, in dem sich die Online-Kulturkriege abspielten, wurde Trump gewählt und so trat das, was wir heute die Alt-Right nennen, in den Vordergrund."), so die Sachbuchautorin Angela Nagle in ihrem erhellenden Buch "Kill all Normies".
Da der Punkt enorm wichtig ist, hier nochmals eine Wiederholung: Die Kultur der Digitalität ist nicht gut oder schlecht. Sie beschreibt eine Realität, die sich herausgebildet hat, die das Digitale als Anker- und Referenzpunkt hat und als neuartige Form der gemeinsamen Bedeutungserstellung nutzt.
Schlussfolgerung
Innerhalb von Stalders Buch sind das also die Prozesse, die definiert werden und mit denen die Anwender zu einer genaueren Beschreibung gelangen können. Erst im letzten Teil wird aus dieser Beschreibung eine Art Forderung bzw. Kritik abgeleitet. Diese stößt sich daran, dass innerhalb der Kultur der Digitalität die Aushandlungsprozesse meist an der Struktur aufhören. Diese "strukturelle Entkopplung" führt in Stalders Sicht zu formen der "unechten Beteiligung". Mit anderen Worten: Wir können über Twitter kommunizieren, aber wir können auf Softwareebene nicht daran mitarbeiten. Das gilt für alle zentralisierten Netzwerke.
Das ist der Unterschied zwischen einem "postdigitalen" Plattformkapitalismus und offen zusammenarbeitenden "Commons".
"Ein stark formalisiertes Bildungssystem ermöglicht nämlich insofern keine echte Teilhabe, als dass nur innerhalb von Strukturbedingungen gesprochen und "ausgehandelt" werden kann"
Das ist der Anschluss an die Bildung. Ein stark formalisiertes Bildungssystem ermöglicht nämlich insofern keine echte Teilhabe, als dass nur innerhalb von Strukturbedingungen gesprochen und "ausgehandelt" werden kann. Auch hier in anderen Worten: Man kann fordern, dass die Kultusminister*innen das Bildungsministerium reformieren sollen, aber die Forderung geht nur mit dem Ministerium. Man kann es schwer abschaffen und kommunistische Räte an deren Stelle schicken (wenngleich auch dies mittlerweile mitschwingt).
Fazit zur Kultur der Digitalität
Bis dahin ist die Begrifflichkeit nützlich, da sie anders als die "Digitalisierung" (was wird übersetzt) oder die Transformation (etwas wandelt sich, meist mit Blick auf die Technik) kulturelle Praxis in den Blick nimmt. Die von Stalder abgeleiteten Fragen: "Wer sind wir?" Oder: "Was ist gut?" bilden dann jeweils den Handlungsrahmen auch für das, was über die (bei Stalder ja sehr vage) definierte Kultur hinaus geht.
Innerhalb der Bildungsdiskussion könnte der Begriff zeigen, dass die Implikationen der Digitalität (also das, was diese auslöst) thematisiert werden müssen, und dass deren Bedingungen (eben Algorithmizität, Referentialität und Gemeinschaflichkeit) bekannt sein und ausprobiert werden sollten oder, insofern dies schon geschieht, reflektiert werden müssen. Dabei sind wir dann an Schnittstellen die mit Begriffen wie "Medienkompetenz" oder "Medienreflexion" beschrieben worden sind oder sogar auf den Nenner einer "digitalen Mündigkeit" gebracht werden. Ebensogut kann Bildung dort ansetzen, wo sie Partizipation innerhalb dieser Kultur der Digitalität ermöglicht.
In beiden Fällen ist die Kultur der Digitalität - eine nochmalige Wiederholung - die Beschreibung eines neuartigen Handlungsrahmens, innerhalb dessen Aushandlungsprozesse von unterschiedlichen Teilnehmern ablaufen.
Reduzierung und Normierung
Die Verwendung des Begriffs "Kultur der Digitalität" im Bildungsdiskurs konterkariert zuweilen die Offenheit, die durch ihn eigentlich deutlich wird. Dies geschieht auf Grundlage einer Reduzierung und Normierung.
Die erste Reduzierung geschieht auf Grundlage einer ausschließlich positiven Auslegung. Mit anderen Worten: Das Gehörtwerden von (positiv gesehenen) Randgruppen in die Mitte der Gesellschaft wird der Kultur der Digitalität zugeschrieben. Das ist zwar, wie die vorherigen Passagen gezeigt haben, eine Verengung, aber dadurch, dass Stalder sie selbst "vorschlägt", ist eine solche Auslegung nicht weiter verwunderlich.
"Es ist ein radikaler Ansatz"
Das, was ich hier als Normierung bezeichne meint, dass die zuvor beschriebenen Beschreibungskategorien wie selbstverständlich in eine Norm dafür übertragen worden sind, was Bildung sein soll. Die "Kultur der Digitalität" wird damit aus ihrer Funktion als Beschreibung einer Praxis zu einem Axiom, zu einem als absolut richtig erkannten Grundsatz. Oder zu einer Zielsetzung. Es ist ein radikaler Ansatz, der jeder Form von Bildungsdiskussion bis hinein in die Unterrichtspraxis dahingehend überprüft, ob er den Kategorien standhält. Wohl gemerkt: Den eigentlichen Beschreibungskategorien!
Guter Unterricht wird in dieser Sichtweise ein Unterricht, der die Kategorien einbezieht, ja, sich ihnen unterwirft. Um es deutlicher zu sagen: In dieser Sicht kann Unterricht überhaupt nur so zu gutem Unterricht werden. Das entscheidende Wort, das dabei fehlt, ist ein einfaches "auch". Denn dass Unterricht auch die Kultur der Digitalität erfassen sollte, ist unbestritten. Das "auch" ist dabei aber insofern zentral, als dass es wegfällt.
Interessanter Weise wird dabei die Offenheit des Unterrichts, der die Kultur der Digitalität im Blick hat, wie selbstverständlich angenommen. Denn eine Argumentation könnte ja auch in die andere Richtung laufen. Unterricht, der auf die Kultur der Digitalität vorbereitet, könnte auch ein solcher sein, der das Digitale ausschließt, Fakten und Autorität in den Mittelpunkt stellt und keinerlei Diskussionen zulässt. Das mag verwundern, wäre aber, nach meinem Dafürhalten, genauso konsequent. Das ist selbstverständlich kein Plädoyer für einen solchen Unterricht, sondern der Hinweis auf die Perspektiven, die auf die Kultur der Digitalität geworfen werden können.
Exklusivität
Auf dieser Grundlage der Reduzierung und Normierung geschieht ein spannender Schritt. Da Gemeinschaftlichkeit als Kategorie der Kultur der Digitalität ja nicht institutionell definiert wird, sollte man meinen, dass er eine offene Diskussionskultur fördern würde. Dies geschieht jedoch nicht nur nicht, sondern seine Verwendung erzeugt sogar das Gegenteil: Exklusivität.
Die Kultur der Digitalität - oder vielmehr die "richtige" Sicht auf diese - wird so zu einem informellen "Zertifikat", das innerhalb der Gruppe anerkannt werden muss. Ein performativer Widerspruch! Was so abstrakt daher kommt, hat für den Austausch auf Social-Media konkrete Auswirkungen. Wer sich nicht "bekennt", wird ignoriert oder hart angegangen.
"Die exklusive Kultur der Digitalität hat ihre Personae non gratae"
Ein solches Ausschlussverfahren kann ein einfaches "entfolgen" sein, das auf Twitter kurz nach einem "Gespräch" verdeutlicht, dass weiterer Austausch nicht mehr gewünscht wird. Es kann bedeuten, dass feierlich verkündet wird, dass der Austausch mit bestimmten Leuten gar nicht mehr erwünscht ist. Das Ganze wird so weit getrieben, dass der Austausch über Grundmaximen unerwünscht ist. Die exklusive Kultur der Digitalität hat ihre personae non gratae. Dies führt zu zwei weiteren interessanten Widersprüchen: Zum einen wird der Kreis derer, die "offen" diskutieren können, so enger. Und zum anderen wird die Perspektive auf Schule und Bildung so radikaler.
Die Beispiele dafür aufzuführen, würde den Rahmen sprengen, aber die (teilweise sehr naiv anmutenden) aus der exklusiven Kultur der Digitalität abgeleiteten Überzeugungen verwerfen beispielsweise das Erlernen von Fakten oder Formalia auf der Grundlage der Annahme, dass man ja alles googeln könne. Das ist ein wenig, als würde man einem Kind auf einer Insel das Schwimmen verbieten, da ja überall Wasser ist.
Übernahme der Verwendung
Viele Diskursteilnehmer, die von der Kultur der Digitalität sprechen, haben die Reduzierung, die Normierung und damit den exklusiven Charakter des Begriffes entweder stillschweigend, nicht-reflektiert oder wohlwollend übernommen. Damit verstärken sie eine in der Bildungsdiskussion zunehmende Polarisierung.
In der einfachen Übernahme machen sich so Beteiligte zu tragenden Säulen einer exklusiven Gruppe. Man mag annehmen, dass dies gewollt und gewünscht ist, was man daran sehen kann, dass die geforderte Offenheit allein schon durch immer neue institutionell verankerten Gemeinschaften konterkariert wird. Nur wer sich anmeldet, ist Teil der Offenheit. All das ist wenig verwunderlich und natürlich auch ein Teil des Phänomens, das ja durch den Begriff beschrieben wird.
Dennoch erscheint die Widersprüchlichkeit des Anspruchs von Offenheit bei gleichzeitiger Exklusivität merkwürdig bis befremdlich. Die Absage an Austausch erscheint hier nurmehr als Anspruch einer Deutungshoheit, die nicht an anderen Perspektiven interessiert ist.
Standardsituationen der Moralisierung
Auf dieser Grundlage erscheinen die immer häufiger auftretenden Filter Clashes (wie der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Filterblasen nennt) als gewollte Form moralisierenden Überheblichkeit. Aus dieser ergeben sich keine Fragen, sondern Urteile. So werden Grenzen gezogen: Ein Ihr und Wir, das jede tatsächliche Debatte verhindert.
Die exklusive und normierte Kultur der Digitalität ist damit das Ende der Debatte, die sie vorgibt führen zu wollen. Sie ist eine Kultur der Parallelität, die Mithilfe der Digitalität zementiert wird.
Fazit
Die kritische Betrachtung hat gezeigt, dass die Kultur der Digitalität zunächst einmal Prozesse beschreibt, die die Digitalität zunächst katalysiert und befördert, dann hervorgebracht hat. Es sollte deutlich geworden sein, dass die Beschreibungskriterien immer dann nützlich sind, wenn es darum geht, wie innerhalb gemeinsamer Bedeutungsherstellung Dynamiken und Prozesse ablaufen. Das ist für Schule und Bildung sehr interessant und sinnvoll.
Dabei wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, auf die Unterscheidung zwischen Beschreibungskriterien auf der einen und darauf abgeleiteten exklusiven geteilten Zielvorstellungen auf der anderen Seite hinzuweisen. Diesen Unterschied zu kennen und zu erkennen ist zentral für offene Gespräche über Bildung um 21. Jahrhundert.
Die Kultur der Digitalität bildet für eine solche Bildung dann einen Rahmen, wenn sie nicht auf eine Zielvorstellung reduziert, ausschließlich positiv gesehen und exklusiv verstanden wird. Wird sie so verstanden, erzeugt sie das Gegenteil von dem, was sie nach den Angaben des Autors Felix Stalder eigentlich will: Menschen an der Verhandlung von sozialer Bedeutung zu beteiligen.
Folien zum Vortrag beim Digitalkongress 2021 vom ZSL
7 comments on “DISKUSSION: Kultur der Digitalität - eine kritische Betrachtung”
-
-
[…] DISKUSSION: Kultur der Digitalität – eine kritische Betrachtung […]
-
[…] Selbstverständlich würde ich niemals schreiben, wem man nicht folgen sollte. Das schöne an der Kultur der Digitalität ist ja ihre Offenheit, auch wenn nicht alle danach […]
-
[…] Ziel ist es, dass reflektiertes Lernen im digitalen Wandel, eines, das auch die Kultur der Digitalität ernst nimmt, Anschluss findet. Anschluss findet auch bei denen, die den massiven Veränderungen […]
-
[…] Digitalität bestimmt zunehmend unser Leben. Das beeinflusst auch den Unterricht, selbst dann, wenn er nicht […]
-
[…] Kultur der Digitalität ernst nehmen Digitalisierung ist kein Extra-Fach. Digitalität verändert alle […]
-
[…] Kultur der Digitalität ernst nehmen Digitalisierung ist kein Extra-Fach. Digitalität verändert alle […]
Schreibe einen Kommentar










