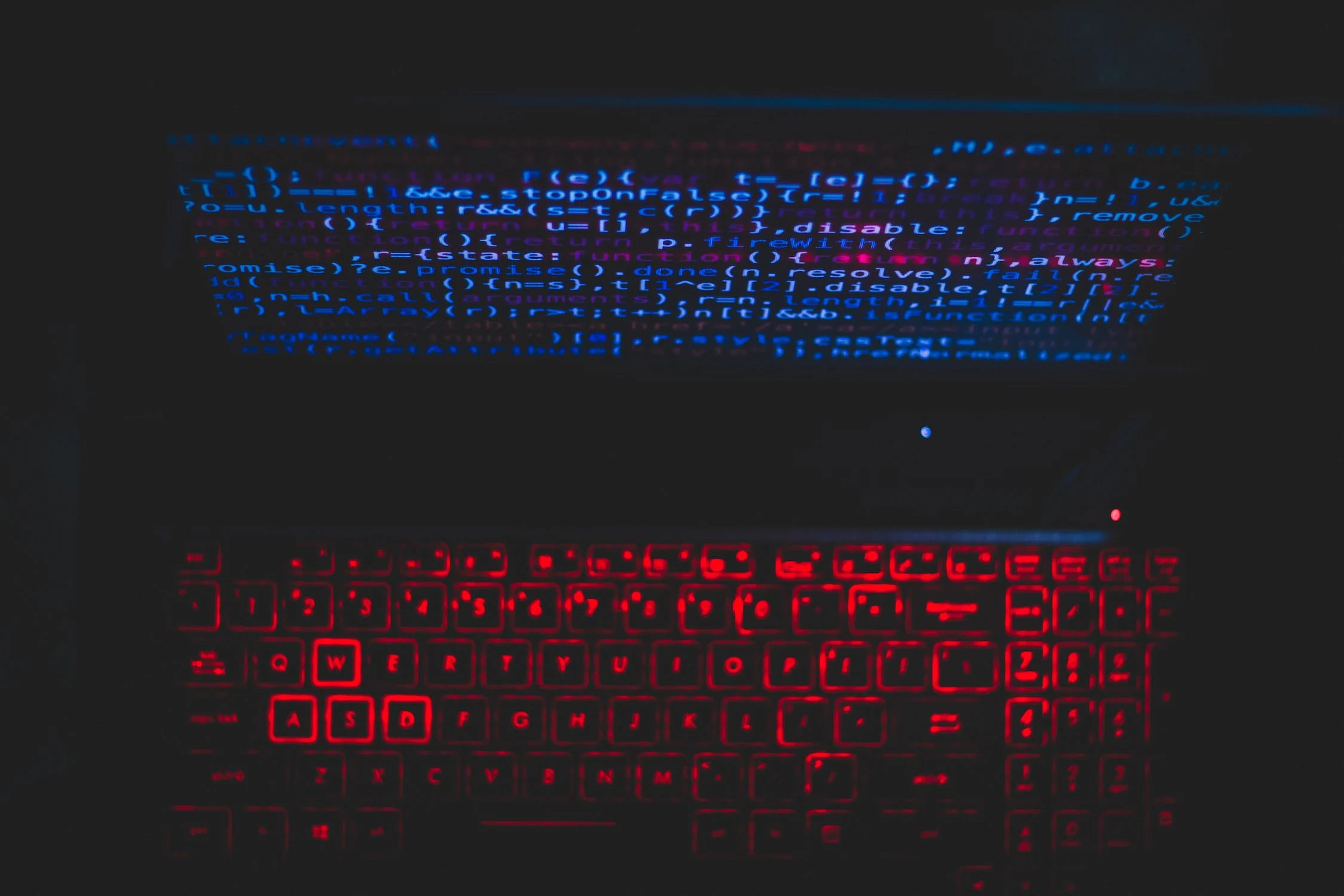Danke fur den Artkel. Genauso bei uns in den USA.
GASTBEITRAG: Verwünscht und zugenäht: Schulschließungen aus Elternsicht

In der Zeit der Schulschließungen kommt es noch mehr als sonst darauf an, die Perspektiven derer zu sehen, die in einer völlig anderen Situation sind als man selbst. Für Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Unterricht gerade völlig neu entdecken, umstellen und anpassen müssen, heißt das, auch darüber nachzudenken, wie das ganze im wahrsten Sinne des Wortes ankommt. Aus diesem Grund bin ich froh und glücklich, dass die Journalistin, SPIEGEL-Bestseller-Autorin und Mutter von vier Kindern, Nora Imlau, diesen Artikel geschrieben hat, in dem sie von ihren Erfahrungen berichtet. Mein herzliches Dank an dieser Stelle für diese Einblicke.
Verwünscht und zugenäht: Schulschließungen aus Elternsicht
Von Nora Imlau
Vor unendlich langer Zeit, an einem Montagmorgen im Februar, machten meine Kinder und ich einen folgenschweren Fehler: Wir wünschten uns was. Und zwar sehr. Es war der erste Schultag nach den Winterferien, der Wecker hatte uns unerbittlich um sechs aus unseren Träumen gerissen, und draußen war es noch stockdunkel, als wir am Frühstückstisch saßen. „Ich wünschte“, sagte also meine Tochter, „es wäre keine Schule. Ganz lange nicht! Wir wären einfach alle zu Hause!“ „Oh ja“, fiel ich ein. „Nicht nur keine Schule, auch keine Termine! Kein Rumgefahre zum Klavierunterricht, kein Warten vor der Turnhalle, keine Dienstreisen!“ Wir waren uns alle einig: Das wäre traumhaft. Pause von allem, Zeit für uns. „Aber leider unmöglich“, sagte mein Mann. „Kommt, es ist schon fast halb sieben!“
Wie fern sich der Gedanke an diesen Morgen anfühlt. Als wäre es Jahre her, dass unser Alltag hier noch so ablief wie immer, als wir morgens unseren mit Pausenbroten, Turnbeuteln und Trinkflaschen beladenen Töchtern hinterher winkten, die auf ihren Rädern losflitzten Richtung Schule. Dabei ist es gerade mal zwei Wochen her, dass die Schulen schlossen und die Kindergärten gleich mit. Dass mein Mann sich seinen Schreibtisch im Kinderzimmer unserer mittleren Tochter einrichtete und wir unserer Ältesten verboten, bei ihrer besten Freundin zu übernachten, weil uns klar geworden war: #flattenthecurve klappt nur, wenn wir auf alle persönlichen Begegnungen außerhalb unserer Kernfamilie verzichten. Seitdem sind wir alle sechs komplett isoliert: Unsere Gymnasistin, unsere Grundschülerin, unser Kindergartenkind, unser Baby. Und natürlich wir Erwachsenen.
Ich gebe es ehrlich zu: Als mich die Nachricht von den Schulschließungen erreichte, fühlte sich das für mich erstmal nach einer guten Nachricht inmitten all der Katastrophenmeldungen rund um das Corona-Virus an. Ich war erschöpft von unserem durchgetakteten, stressigen Schulalltag und hatte die Illusion, die schulfreie Zeit würde so ein bisschen wie die letzten Sommerferien werden, in denen mein Mann nach der Geburt unserer jüngsten Tochter Elternzeit nahm: Alle hatten frei, keine Pflicht drückte, und das Leben war schön. Natürlich war das naiv, und aus heutiger Sicht der Dramatik der Situation gewiss nicht angemessen. Doch so funktioniert das menschliche Gehirn manchmal im Krisenmodus: Es klammert sich an allem fest, was Halt verspricht. Für mich war das dieses Bild: Kein Weckerklingeln, kein Schulstress. Stattdessen: Viel gemeinsame Familienzeit. Dann trudelten die ersten E-Mails ein: Aus der Schule, mit Aufgaben für unsere Kinder. Von der Arbeit meines Mannes, mit ellenlangen To-Do-Listen fürs Home Office. Dazu die Wut der Kinder: Warum dürfen wir nicht mehr ins Kino, ins Einkaufszentrum, in die Stadt? Andere Eltern erlauben das aber noch! Kurz darauf kam das Kontaktverbot.
Nein, das sind keine Ferien. Das ist eine Krisenzeit, im Großen wie im Kleinen. Die Nachrichten jeden Tag wie der Beginn eines Katastrophenfilms: mehr Infektionen, mehr Tote, die Weltkarte färbt sich rot. Grenzen schließen, das öffentliche Leben steht still. Verzweifelte Ärzte, die aus Krankenhäusern berichten, die mehr Lazaretten ähneln. Schwerkranke Patienten, die in Fluren auf dem Fußboden liegen. Die unmenschliche Wahl, wer ein Beatmungsgerät bekommt und wer nicht. Und gleichzeitig singen draußen die Vögel, und unser dreijähriger Sohn steht am Fenster und weint, weil er nicht im Garten mit dem Nachbarskind spielen kann wie jeden Frühling. Selbstisolation als Schutzmaßnahme – wie erklärt man das einem Kindergartenkind?
Über Alltagsprobleme zu schreiben in Zeiten einer globalen Pandemie ist nicht leicht. Fast fühlt es sich verboten an, den Stress zu thematisieren, den das Fernlernen in diesen Tagen so mit sich bringt, der Wegfall aller Routinen, die schmerzlich vermissten Freunde. Und doch sind diese kleinen Krisen Teil der großen, und nicht egal, nur weil es bei ihnen nicht um Leben und Tod geht. Die Welt unserer Kinder ist aus den Angeln gehoben, und mit Langeweile klarzukommen, ist – anders als mannigfaltige Artikel suggerieren – für Familien derzeit das geringste Problem. Stattdessen müssen wir den Balanceakt schaffen, unsere Kinder mit Zuversicht durch eine Zeit der Unsicherheit zu begleiten, von der niemand weiß, wie lange sie andauern wird, und dabei gleichzeitig Hilfslehrer, Streitschlichter und Spielkameraden zu sein. Oh, und dann gilt es plötzlich noch ständig essen zu machen, den Haushalt einigermaßen in Ordnung zu halten und den eigenen Job zu erledigen. Überforderung, dein Name ist Corona-Krise!
Die erste Woche war eine Katastrophe. Wir Eltern checkten alle paar Minuten mit schreckgeweiteten Augen auf unseren Smartphones die neusten Schreckensmeldungen, und unsere Kinder spiegelten uns unsere eigene unruhige Sorge in Form von Wutausbrüchen zurück: Scheiß-Arbeitsblätter! Blöde Schul-E-Mails! Alles Mist! Jetzt, in der zweiten Woche, hat sich langsam eine Art Routine herausgebildet. An unserem Esszimmerschrank hängt jeweils ein grober Plan für den Tag. Auf dem stehen bewusst keine festen Uhrzeiten, aber Abfolgen, durch die eine gewisse Struktur entsteht: Erst die Aufgaben aus der Schule erledigen, dann Mittagessen, dann spielen, basteln, malen oder Hörspiele hören. Und dann erst fernsehen.
Damit fahren wir momentan ganz gut. Mit dem selbstständige Abarbeiten ihrer Arbeitsaufträge kommen unsere Kinder erstaunlich gut zurecht. Vielleicht liegt es daran, dass sie als Montessori-Schülerinnen Freiarbeit gewohnt sind, vielleicht haben wir auch einfach Glück gehabt und die Schul-Zwangspause fällt hier in eine eher kooperative Entwicklungsphase. Unsere Siebtklässlerin erledigt jedenfalls alles, was anliegt, gemeinsam mit ihrer besten Freundin, verbunden per Videotelefonie auf ihrem Smartphone, und ist damit jeden Tag bestimmt fünf Stunden beschäftigt. Unsere Viertklässlerin arbeitet lieber allein und lässt uns nachher die Ergebnisse kontrollieren. Dafür ist sie meist schon nach etwa neunzig Minuten fertig. Allerdings machen wir hier auch nicht mehr als das Minimalprogramm, das die Schule vorgibt: Während ich auf Instagram bestaune, wie andere Eltern noch zusätzliche Themenwochen konzipieren und Lernspiele entwickeln, bin ich nämlich schon stolz auf mich, wenn ich es schaffe, unsere beiden jüngeren Kinder während der Lernzeit der Großen von den lärmendsten Spielsachen fern zu halten. Danach bin ich platt. Und habe ganz sicher keine Energie mehr für kreative Vokabelübungen. Wie muss das erst für Eltern sein, die noch mehr Stress und noch weniger Ressourcen haben?
„Wenn plötzlich keine Schule mehr ist, merkt man erst, was Schule eigentlich alles ist“ – es war Tag 7 der neuen Zeitrechnung, als meine mittlere Tochter diesen Satz zu mir sagte. Und sie hat so recht! Die Aufgaben, die unsere morgens von der Schulwebsite herunterladen, mögen dazu beitragen, dass sie bereits Gelerntes nicht komplett vergessen, und ihnen vielleicht auch den einen oder anderen neuen Inhalt vermitteln. Doch im Vergleich zum Schulalltag mit all seinen sozialen Interaktionen sind sie nicht mehr als ein blasser Abklatsch von dem, was da eigentlich hätte sein müssen. Nicht umsonst sagen Lernpsychologen, dass soziale Beziehungen entscheidend ist, wenn Neues im Gehirn verankert werden soll. Mimik, Gestik, echter Kontakt – wie soll das aus der Ferne gehen? Tatsächlich machen hier scheinbare Kleinigkeiten einen immensen Unterschied. Alles, was den Kindern zeigt: Ihr seid für uns mehr als nur ein Job. Der kurze persönliche Gruß, der den neuen Aufgaben beigefügt ist. Eine Postkarte von der Lehrerin. Ein überraschender Anruf des Klassenleiters: Wie geht es dir denn so in dieser Ausnahme-Zeit? Eine Lehrerin hat jetzt sogar einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, um mit ihren Schützlingen enger verbunden zu bleiben. „Ich glaube, die vermissen uns wirklich“, sagte meine älteste Tochter dazu ganz erstaunt. „Klar“, bestätigte ihre kleine Schwester. „Für die ist das doch hier genauso komisch wie für uns.“
Eine Pandemie ist kein Selbsterfahrungstrip. Und nach zwei Wochen Fernunterricht unter Quarantänebedingungen ein abschließendes Fazit zu ziehen, wäre vermessen. Doch was mir die zwei Wochen Selbstisolation zu sechst bereits jetzt gezeigt haben, ist, dass eine Krisenzeit wie diese nicht nur unendlich viel mehr emotionalen Stress bedeutet als jeder noch so fordernde Familienalltag – sie macht auch spürbar, wie existenziell wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind, gerade auch im schulischen Kontext. Denn was unter Normalbedingungen leicht nebenbei passiert, muss jetzt bewusst und durchaus aufwändig geschaffen werden: Möglichkeiten der Verbindung, Zeichen des Interesses aneinander, echter, interessierter Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden. Gelingt das, gelingt Schule auch in der Ferne – zumindest übergangsweise, wenn sie muss, weil es gerade nicht anders geht.
„Und, was hast du heute gelernt?“ Wie jeden Abend schreibe ich gemeinsam mit meiner Tochter in ihr Lerntagebuch. Zwei Seiten Mathe, notiert sie. Zwei Seiten Deutsch. „Und ich habe gelernt, dass wir genauer wünschen müssen“, sage ich. „Einfach keine Schule zu wollen, war offensichtlich zu ungenau.“ Sie lacht. „Ja, wir hätten uns besser extralange Sommerferien gewünscht“, sagt sie dann. „Und superlange Weihnachtsferien und noch eine Woche mehr frei zu Ostern. Und dazwischen richtig schöne, ganz normale Schule!“
Artikelfoto: Thomas Clemens
4 comments on “GASTBEITRAG: Verwünscht und zugenäht: Schulschließungen aus Elternsicht”
-
-
[…] oder Eltern und Schüler*innen sind. Da ich die Perspektive der Journalistin und Mutter Nora Imlau aus dem ersten Gastbeitrag ungemein gewinnbringend fand, habe ich auf Twitter nachgefragt, ob es auch andere Beispiele für […]
-
[…] veröffentlichte ich Gastartikel von Eltern, um auch ihre Perspektive einzubringen (z.B. hier oder hier). Und das im Übrigen immer in einer Zeit, in der gerade auf Social-Media die (nachvollziehbare) […]
-
Ein eindrücklicher, ehrlicher und wunderbar einfühlsamer Text – danke, dass hier die Perspektive von Eltern so greifbar sichtbar gemacht wird. Gerade die kleinen Beobachtungen im Ausnahmezustand – zwischen Videotelefonie, Arbeitsblättern und Weinen am Fenster – berühren mehr als jede nüchterne Analyse. Was bleibt, ist ein starkes Plädoyer für mehr Menschlichkeit im Bildungssystem – auch jenseits der Krise.
Schreibe einen Kommentar zu GASTBEITRAG: #unterrichtdigital – bei uns läuft es! | Bob Blume Antwort abbrechen