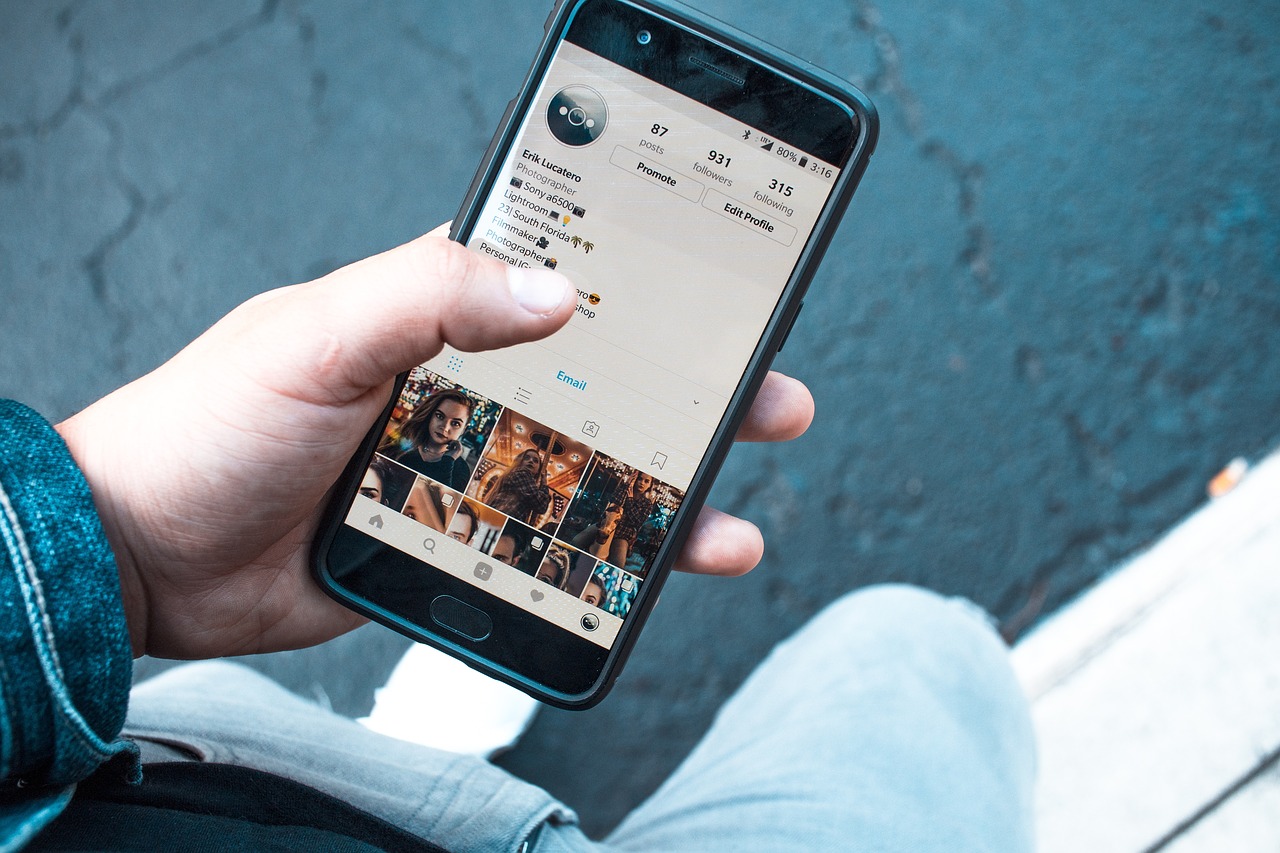Ähnliche Kommentare bzgl. "Zurückhaltung" musste ich mir auch anhören. Bin aber weiter "ich". 🙂
REFERENDARIAT: Referendars-Gedanken, Folge 2: Tage der Demut

Es ist schwer ins Lehrerzimmer zu gelangen, wenn der Rektor auf der anderen Seite dagegen drückt. Er tut es aber, weil er denkt, dass ich ein Schüler bin. Das macht es nicht einfacher. In den Klassen ist das anders. Da ist man noch cool, was bedeutet, dass einem zugehört wird. Also in der ersten Woche.
Das Lehrerzimmer ist eine Inselgruppe im Krieg. Aber das weiß ich noch nicht und schlendre wie ein Todesmutiger durch die verminten Gebiete, voller hoffnungsfroher und naiver Innovationsgedanken. Zumindest in den ersten Wochen, in denen ich noch hinten sitze und den Lehrern beim Unterrichten zuschaue. Das kann ich alles besser, denke ich und sage es keinem (worüber ich mich hinterher freue).
Die Sekunden, in denen die Klasse als Referendar betreten wird, sind entscheidend über die ersten Wochen. Die kleinen und die großen Terminator-Schüler analysieren blitzschnell. Kleidung, Auftreten, Stil, Mode; und dann fällt das Urteil. Cool oder Opfer.
In meiner Klasse weiß ich nach ein paar Stunden immer noch nicht, was sie von mir halten, denn sie sagen nichts. Sie schauen mich nur an. Nicht böse, nicht wütend. Nur gelangweilt und leicht ablehnend, dass ich als junger Mensch sie hier aufhalte im Zimmer des Verderbens ihrer ewig währenden Party-Jugend. Ich habe keine Probleme mit der Lautstärke, bin mir aber nicht sicher, ob alle des Sprechens mächtig sind (Kleine Vorschau: Ich werde diese Klasse so sehr mögen, dass ich zwei Jahre später bei der Abiturveranstaltung Britney Spears für sie singe, vor der gesamten Elternschar und fast allen Lehrern der Schule). Jetzt aber sind sie still, was mir sorgen macht, da mein Fachleiter sich angekündigt hat. Ich bin mit Gedanken also schon in einer anderen Klasse. 6. Klasse. Geschichte. Das trojanische Pferd.
Das Problem, das ich habe, heißt Authentizität. Das, was alle wollen, aber von dem keiner weiß, wie man es kriegt. Ich bin zum Beispiel flapsig, manchmal überschwänglich oder spaßig. Ist eine Antwort falsch (also in den Klassen, die sprechen) tue ich schon einmal so, als schlage ich mit dem Kopf gegen die Wand, ist eine Antwort sehr gut, befeuere ich das Engagement mit Superlativen.
„Schau doch mal, dass du dich da etwas zurück nimmst“, rät mir ein Kollege, den ich sehr schätze, weil er immer gute Tipps hat und immer so scheint, als habe er alles im Griff (nachdem das Abitur anbricht und ich erkenne, dass selbst dieser Kollege in eine gerade zu manische Arbeitsphase mit unterbrochenen depressiven Tendenzen rutscht, verzweifle ich über die Ungerechtigkeit der Lehrer-Welt, in der ich es nie schaffen werde).
Ich soll also mehr mit dem Kopf nicken, den Schülern zu. Ein anderer Kollege findet, dass ich die Hände nicht in die Hosentasche stecken soll, wegen den Auswirkungen der Körpersprache auf die jungen Seelen (Ich frage mich insgeheim, ob meine Hände in den Taschen mit den FKS 18 Spielen mithalten können, die meine 6er schon spielen, behalte das aber wieder für mich). Ich solle die Hände in einer Raute vor den Körper halten. Verkneifen Sie sich die Kommentare. Unsere Bundeskanzlerin hatte diese resignative Pose damals noch nicht als Staatseigentum gekennzeichnet.
Am Tage der Unterrichtsbesuche ändert sich das Mienenspiel der Lehrer, die einen kennen. Selbst die, die sich im Lehrerzimmer auf einer anderen Insel befinden und eigentlich die Kanonen im Anschlag haben (zum Beispiel, weil sie finden, das die Kollegen des anderen Fachs sich immer zu viel rausnehmen und überhaupt), nicken einem freundlich oder resignativ, vor allem aber mitleidig zu, weil sie wissen, das hier die jungen Seelen zerschlagen werden. Also die der Referendare. Denn die Schüler sind meist junge Lämmer, die alles ganz toll machen wollen. Das führt dann schon einmal dazu, dass eine Stunde viel zu lange dauert, weil die lieben Kleinen meinen, dass sie jede Frage mit einer klassischen Abhandlung über ihre Kindheit abrunden sollten.
Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal wird alles anders, toll, innovativ. In der Stunde, die in sündenhaft langen, verschrobenen Didaktik-Sätzen auf 15 Seiten gemorpht wird, damit der Fachleiter die unglaubliche Neuigkeit erfahren können, dass es sich „um eine heterogene Klasse“ handelt, bei der „vor allem die Mädchen“ durch Interesse bestechen. In der Mitte steht die Information, dass ein ganz besonderer Schwerpunkt in der Stunde im Mittelpunkt steht, der die Schüler nicht nur weiterbringen, sondern ihr gesamtes Leben beeinflussen, ja, sie vielleicht jetzt schon zur ultimativen Weisheit des Lebens führen wird.
Nicht nur der vor Angstschweiß triefende Pullover des armen Würstchens vor der Klasse zeigt die Besonderheit der Situation an. Die armen Schüler, in deren unmittelbarer Entfernung der Fachleiter sitzt, sind ganz nackensteif, trauen sich nicht, sich umzudrehen und sehen aus, als würden sie bald ohnmächtig. Ich frage mich, als die Situation da ist, ob ich in einem solchen Falle meine Raute aufmachen darf, komme aber nicht dazu. Vor mir lächelt ein Schüler, der Stunden zuvor in Tränen ausbrach, nachdem ich ihm mit verbotener Nutzung von Ironie in der Unterstufe nach einer Flatulenz androhte, ihn zur Strafarbeit zu bitten. Mittlerweile hat er mir verziehen und lüftet sichtlich erleichtert Hemd und Hose.
Nach einer Phantasiereise in das alte Griechenland und nach Troja kommt die glorreiche Innovation, das Herz meines Unterrichts, das nun dem Fachleiter ein für allemal zeigen soll, wie toll ich didaktische Konzepte in die Praxis übertragen kann. Statt langweilige Quellen zu interpretieren sollen die Schüler sich direkt in die Geschichte beamen (Hinweis: Im Gegensatz zu einer bestimmten Kollegin verzichtete ich darauf, eine Zeitmaschine zu basteln, weil mir die Idee zwar interessant erschien, ich jedoch seit dem Zeitpunkt, als dies bekannt wurde, etwas Angst vor jener engagierten Junglehrerin entwickelte).
Das Zauberwort hieß: Handlungsorientierung. Ein wunderbarer Arbeitsauftrag forderte die Schüler auf, über ihre Erlebnisse im trojanischen Pferd zu schreiben, wie sie die Welt und Troja sehen würden, was sie täten. Geschichte ganz nah eben. Nachdem ich den Arbeitsauftrag erteilt habe, wird es schlagartig still. Der Fachleiter ist sichtlich zufrieden und ich bin es auch. Ich löse langsam die Hände aus der Raute und versuche meinen Nacken zu entspannen, der vom ewigen hin und her meiner Rückmeldungen ohne Enthusiasmus ganz steif ist. Noch bevor ich fragen kann, melden sich zehn jungen. Ich traue meinen Augen nicht, aber freue mich und bitte den ersten, von seinen tollen Ereignissen zu berichten. Er geht vor.
„Ich stürze aus dem Pferd. Es kommt eine Frau, ich schlage ihr sofort mit dem Schwert den Kopf ab...“
Mit wird unwohl. Der Rest, der nun kommt, wird von mir überhört, weil ich nicht weiß, was ich weiter machen soll. Ich frage, ob noch jemand möchte und bete, dass keiner mehr etwas Gescheites hat. Ja, es wollen noch mehr.
„Als ich aus dem Pferd stieg, brannte die Stadt. Es kam ein Kind, das schrie, weil seine Mutter in flammen stand. Ich stieß ihm meinen Speer...“
Meine Hände sind mittlerweile in ein mathematisches Konstrukt verschwommen, das sich nicht mehr bewegen lässt. Ich schaue starr an die Decke und versuche zu erörtern, welchen Beruf ich als Alternative auswählen kann. Nach zwei weiteren blutrünstigen Schilderungen vergleichen wir die Erlebnisse mit einer Quelle, schreiben etwas an die Tafel und ich gebe Hausaufgaben.
Ich verabschiede mich bei den Schülern und erkläre meinem Fachleiter, dass ich kurz auf die Toilette möchte. Dort trockne ich eine Träne und gehe in den Raum, in der die wichtigste Person der ganzen Schule – die Sekretärin – schon Schokolade und Kaffee für die geschundene Seele hingestellt hat. Und für den Fachleiter. Der lässt mich erklären, was denn alles falsch gelaufen sei.
Zu meiner Überraschung findet er das alles halb so schlimm. Aber er fragt, was denn heute mit mir los gewesen sei. Es sei doch sonst anders gewesen, lockerer irgendwie. Auch die Haltung hätte befremdlich gewirkt.
Ich könnte ihm glatt um den Hals fallen.
Nach dieser Erfahrung verabschiede ich mich feierlich von drei Dingen, die ich nie wieder in dieser Form nutzen werde: Der Raute mit den Händen, dem Nicken ohne Gefühlsregung und einer Handlungsorientierung in Zusammenhang mit Krieg und Leid in einer Klasse, von der ich weiß, dass der Großteil der Freizeit im virtuellen Töten von Gegnern im Internet besteht.
Ich schleiche zum Lehrerzimmer. Mein Blick ist leer, aber ich bin glücklich. Diesmal lässt mich der Rektor rein. Alle fragen, wie es war. Ich kann da nicht soviel zu sagen und setze mich stattdessen auf die Couch, mein Blick in die Ferne gerichtet, die Hände zu einer Raute verschränkt.
Wenn das eine Besuchsstunde war, was wird dann mit der Lehrprobe? Demut breitet sich aus...
Wer noch mehr erfahren möchte, kann das Buch "Das Abc der gelassenen Referendare" käuflich erwerben. Es richtet sich an Lehramststudentinnen und Studenten sowie an Referendarinnen und Referendare, die schon vor oder beim Beginn ein paar hilfreiche Tipps gebrauchen können.
Man kann es hier über Amazon oder auf der Seite des Verlags kaufen.
Hier geht es zu
Referendars-Gedanken, Folge I: Tage des Zorns
Referendars-Gedanken, Folge III: Tage der Erschöpfung
Anmerkung: Auch wenn ich hier als Autor über eigene Erfahrungen schreibe, sind die in den humoristischen Texten vorkommenden Personen keine realen Menschen, sondern Zusammenschnitte aus subjektiven Eindrücken, die auf die Spitze getrieben sind. Keiner sollte sich hier verärgert oder angegriffen fühlen. Am besten kann man dies an meiner Beschreibung von Referendaren sehen, bei der ich in jedem einzelnen Fall auch mich selbst meinte.10 comments on “REFERENDARIAT: Referendars-Gedanken, Folge 2: Tage der Demut”
-
-
Man sollte das schon berücksichtigen, aber ich finde es jetzt nicht besonders heftig. Danke für deinen Kommentar.
-
-
[…] Referendars-Gedanken, Folge II: Tage der Demut […]
-
[…] Referendars-Gedanken, Folge 2: Tage der Demut […]
-
Hallo Herr Blume,
gerade habe ich Ihren Blog wieder gefunden und auch diese sehr sympathische Serie.
Besonders bei Ihrer Britney-Spears Anekdote konnte ich mir das Schmunzeln nicht verkneifen. 🙂
Deshalb wollte ich Ihnen einfach nochmal sagen:
Vielen Dank, dass Sie nicht nur unseren Abiball, sondern auch die Schuljahre, die wir, wie ich nun weiß, zusammen "durchlitten" haben, zu etwas Besonderem gemacht haben.
Liebe Grüße-
Hi Meike, es gibt immer diese Kommentare, die was Besonderes sind und einem gute Laune machen. Das war so einer. Ja, das Referendariat hat auch viel mit leiden zu tun. Aber ich weiß noch, wie ich mich nach dem Theaterstück gefühlt habe. Da war ich nur stolz. Insofern war es auch eine sehr gute Zeit. Intensiv. Den Dank kann ich nur zurückgeben. Und, bist du schon am "einfach mal machen"? Das hoffe ich doch sehr. Liebe Grüße zurück.
-
-
[…] Referendars-Gedanken, Folge II: Tage der Demut […]
-
[…] Referendars-Gedanken, Folge II: Tage der Demut […]
-
[…] geht es zu Referendars-Gedanken, Folge I: Tage des Zorns Referendars-Gedanken, Folge 2: Tage der Demut Referendars-Gedanken, Folge 3: Tage der Erschöpfung Referendars-Gedanken, Folge 4: Tage der […]
-
[…] Referendars-Gedanken, Folge 2: Tage der Demut […]
Schreibe einen Kommentar zu REFERENDARIAT: „Nein, heute kann ich leider gar nicht“ | Bob Blume Antwort abbrechen