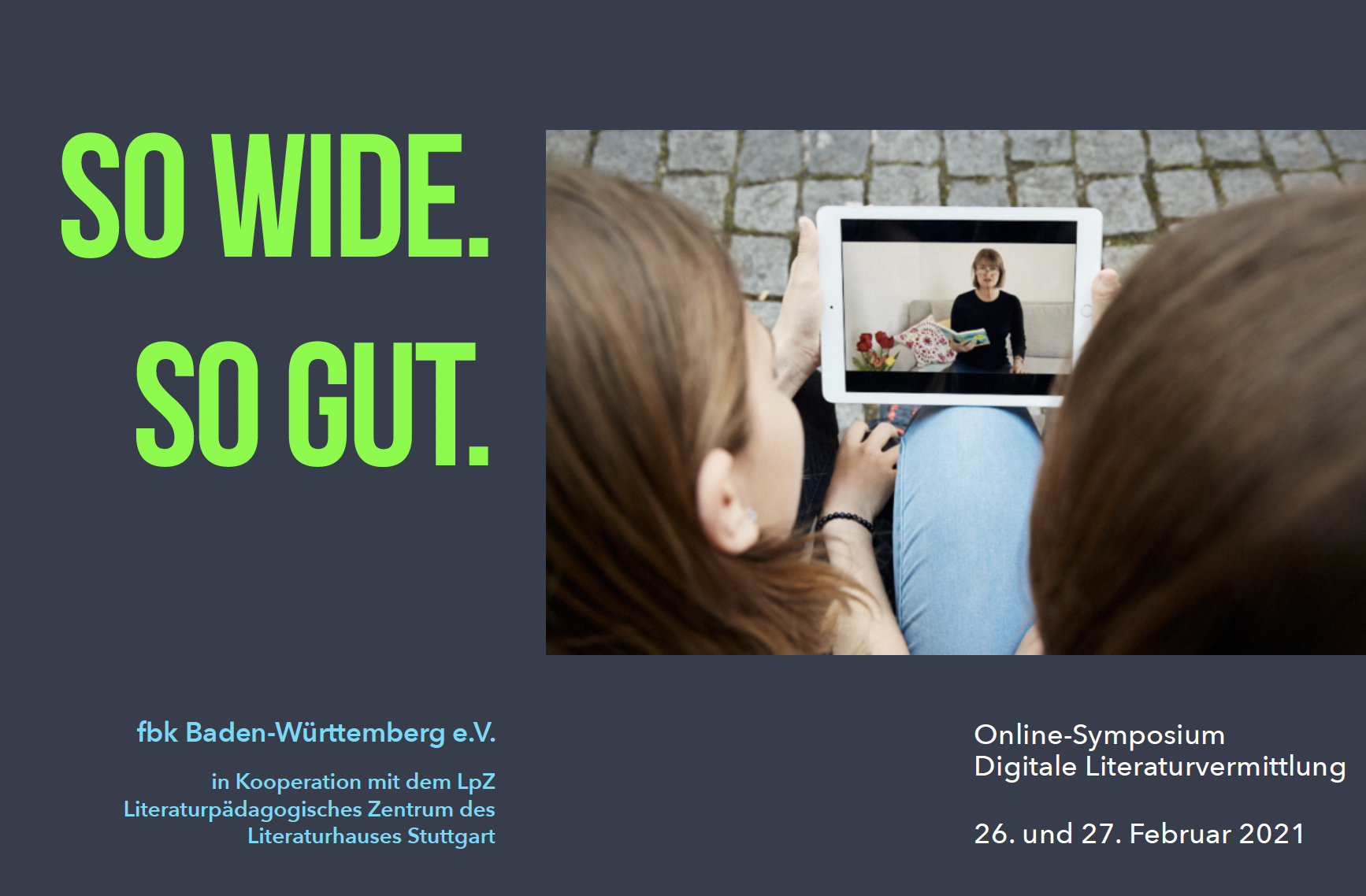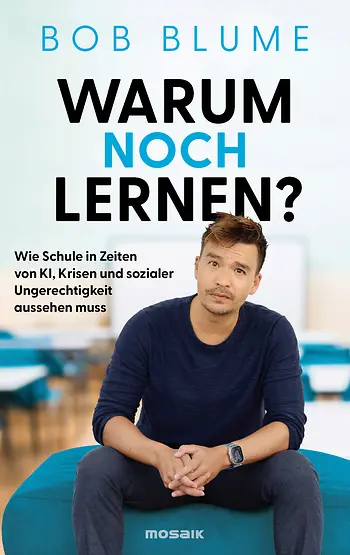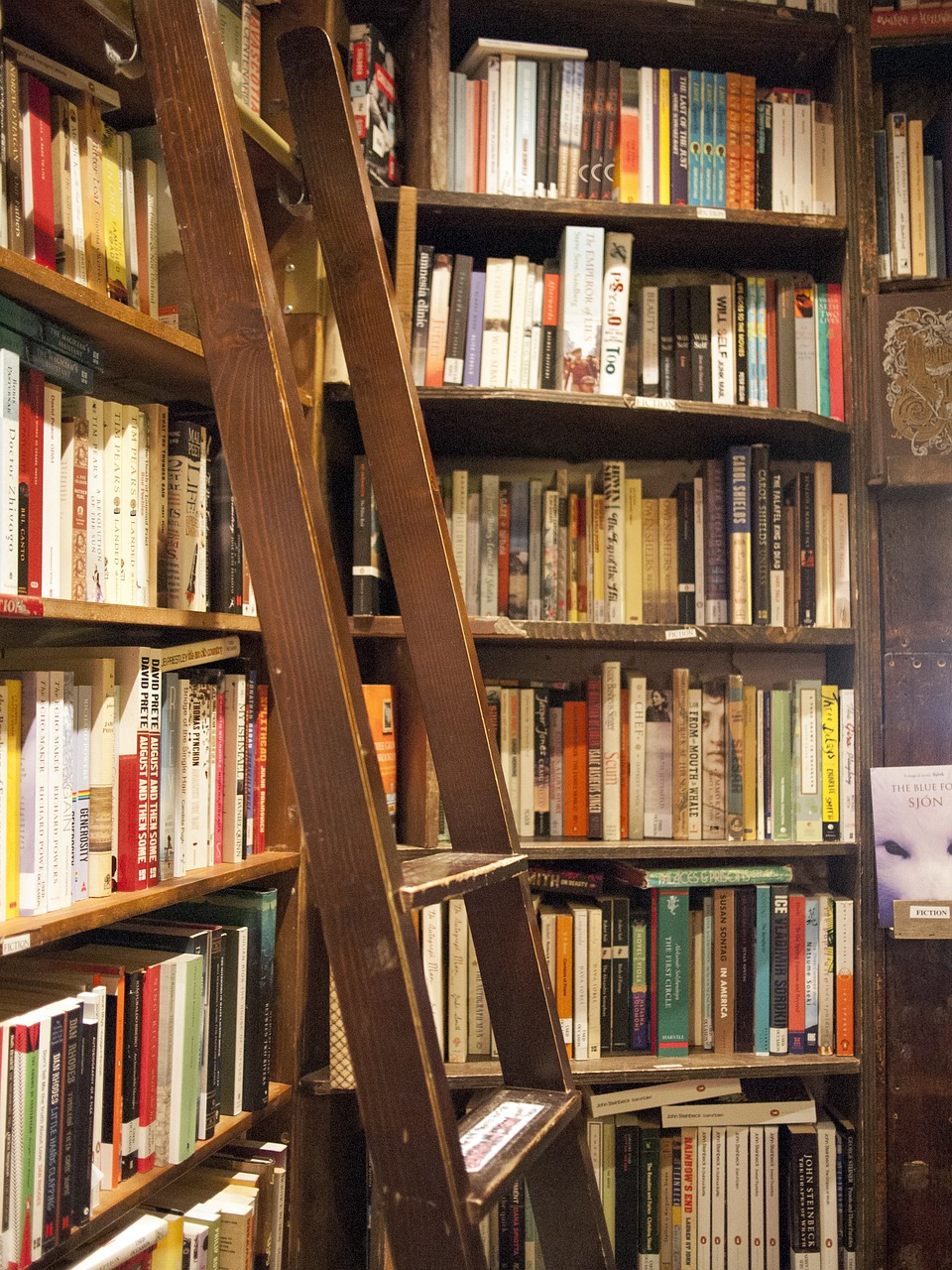Auf dem Online-Symposium für Autor*innen der fbk Baden-Württemberg konnte ich den Eingangsvortrag halten. In diesem ging es um die Frage, wie Lesen und schreiben in der Kultur der Digitalität aussehen und inwiefern der Begriff der Digitalisierung zu einer Reduzierung des Blickwinkels führen kann.
Ziel des Beitrags
Nach einer Empfehlung, dessen Urheber ich leider nicht mehr weiß, gestalte ich meine Vorträge so, dass sie nur dann Sinn ergeben, wenn man selbst dabei gewesen ist, denn: Ein Vortrag, der komplett nachvollziehbar ist, wenn man ausschließlich die Slides liest, bräuchte keinen Vortragenden. Der Beitrag ist insofern in erster Linie für die Zuschauenden als Nachlese gedacht. Es bleibt natürlich unbenommen, dass sich auch jene, die über den Artikel stolpern, die hier angegebenen Empfehlungen anschauen können.
In erster Linie geht es darum, einige Grundthesen nochmals aufzulisten und die angegebene Literatur aufzulisten. In diesem Artikel findet sich auch die Präsentation.
Thesen
In dem Vortrag spielten unterschiedlichste Thesen in Bezug auf die Kultur der Digitalität eine Rolle (der Link führt zu einem Podcast mit Felix Stalder, dem Autor des gleichnamigen Buches). Die hier aufgelisteten Thesen lassen sich nicht 1:1 auf die unten stehenden Slides beziehen, sondern sind im Laufe der Präsentation so oder ähnlich geäußert werden.
- Es geht weniger um Digitalisierung als um eine "Kultur der Digitalität".
- Die verschiedenen Merkmale der Kultur der Digitalität (Gemeinschaftlichkeit, Referentialität, Algorithmizität) führen zu einer Erweiterung der Möglichkeiten und zu einer produktiven Verwicklung.
- Um die Möglichkeiten wahrzunehmen, die diese Kultur bietet, ist es sinnvoll, eine kulturpragmatische Haltung einzunehmen.
- Die eigene Sozialisation kann den Blick trüben (Standardsituationen der Technologiekritik). Deshalb ist das Überdenken der eigenen Wahrnehmung essentiell.
- Vor allem der Blick auf das Wie, also die Wirkung des Digitalen (wie beschrieben beim Dagstuhl-Dreieck) ist sinnvoll, um die Kultur der Digitalität zu verstehen.
- Sich einzubringen bedeutet, sich für diese neuartige Perspektive zu öffnen.
- Betroffen von diesen Entwicklungen sind alle Bereiche des Lesens und Schreibens.
- Auch die Autorschaft ist in der Produktion, der Vermarktung, der Zusammenarbeit und dem Vertrieb betroffen.
- Man kann zunächst beobachten, um dann erste Schritte zu tun, die in völlig neuartige Möglichkeiten der Zusammenarbeit (wie hier anhand des Unterrichts beschrieben) münden können.
- Frei nach Dirk von Gehlen: Vielleicht ist dies auch alles falsch. ¯\_(ツ)_/¯
Literatur
In dem Vortrag habe ich auf verschiedene Bücher hingewiesen, die sinnvoll sind, wenn man sich mit den unterschiedlichen Bedingungen einer Kultur der Digitalität befassen möchte.
- Stalder, Felix: Kultur der Digitalität. Suhrkamp Verlag. 2016.
- Van Gehlen, Dirk: Das Pragmatismus-Prinzip: 10 Gründe für einen gelassenen Umgang mit dem Neuen. Piper; 1.Edition. 2018.
- Döbeli Honegger, Beat: Mehr als 0 und 1. hep Verlag; 2.Edition. 2017.
- Nassehi, Armin: Muster. Theorie einer digitalen Gesellschaft. C.H. Beck 2019.
- Blume, Bob: Abc der wissensdurstigen Mediennutzer. AOL-Verlag 2019.
- Blume, Bob: 33 Ideen digitale Medien Deutsch. Step-by-step erklärt, einfach umgesetzt – das kann jeder! Auer; 3.Edition 2020.
- Frederking, V. (2014a). Symmedialität und Synästhetik. Die digitale Revolution im medientheoretischen, medienkulturgeschichtlichen und mediendidaktischen Blick. In: V. Frederking, A. Krommer & Th. Möbius, (Hrsg.), Digitale Medien im Deutschunterricht. (= Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP). Hrsg. von W. Ulrich Bd. VIII). Baltmannsweiler: Schneider.
- Lindner, Martin: Die Bildung und das Netz. Independently published 2017.
- Allert, Heidrun et al. (Hrsg.): Digitalität und Selbst: Interdisziplinäre Perspektiven auf Subjektivierungs- und Bildungsprozesse (Pädagogik). transcript; 1. Edition. 2017.
- Wampfler, Philippe: Generation Social Media. Vandenhoeck & Ruprecht; 2., durchgesehene Edition. 2018.
Präsentation