Kurze Frage zum Verständnis, das sowieso noch nicht ganz eingesetzt hat:
Ist wirklich transnational gemeint, wenn es im Text steht, oder ist immer transaktional gemeint?
DIGITAL: Bildung als produktive Verwicklung
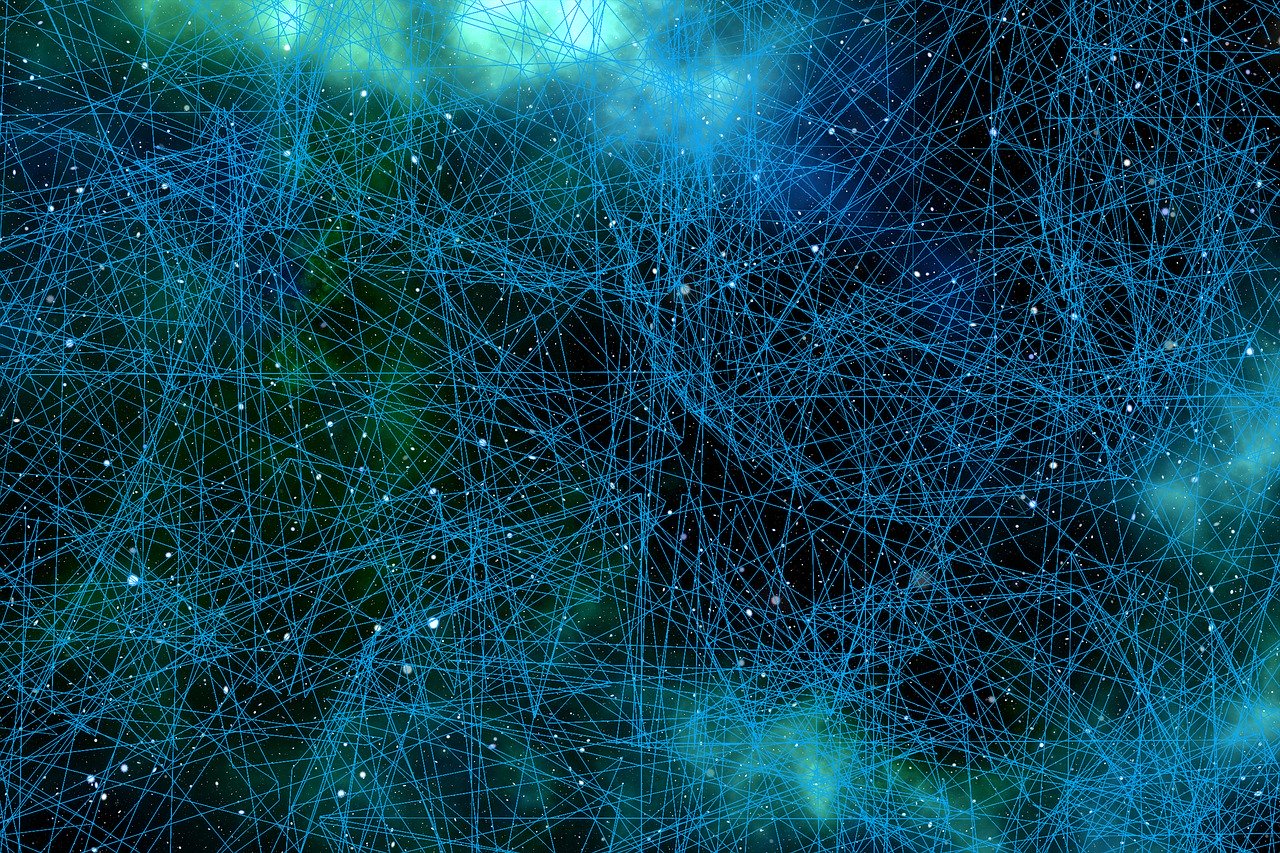
Immer mal wieder gibt es diese Aufsätze, die so vor Erkenntnis sprühen, dass man als Leser*in in eine produktive Aufregung verfällt und am liebsten mehr tun würde als passiv zu lesen. Genau so ging es mit bei dem Grundlagenaufsatz "Bildung als produktive Verwicklung" von Heidrun Allert und Michael Asmussen aus dem Sammelband "Digitalität und Selbst", herausgegeben von den beiden genannten Autoren. Der Aufsatz bringt so vieles auf den Punkt, von dem ich in den letzten Jahren nur eine Ahnung formulieren konnte, gibt fundiert hergeleitete Kategorien an die Hand und präzisiert, was Bildung in einer Kultur der Digitalität sein kann, dass ich dem impliziten Plädoyer folgend mich an dieser Stelle produktiv verwickeln möchte. Dank gilt hier Prof. Dr. phil. Uta Hauck-Thum, der ich den Lektüretipp verdanke.
Ansatz des Blogbeitrags
Der Ansatz des Blogbeitrags ist neben einer grundlegenden Empfehlung, die sich schon aus den einleitenden Sätzen ergibt, eine schreibend beschreibende Umwälzung einiger wichtiger Thesen. Der Beitrag versteht sich weder als Nacherzählung noch als Zusammenfassung, sondern ist zu verstehen als lockere Besprechung, die dem Autor gleichsam als Umwälzung des Erkenntnisgehalts gilt. Anstelle eines durchgehenden Fließtextes werden die wichtigsten Thesen hier isoliert und neu ein- und angeordnet. Ziel soll es im besten Falle sein, dass die Lesenden einen Einblick in diesen erkenntnisreichen Aufsatz bekommen und gleichzeitig mit den grundlegenden Schwerpunkten bekannt gemacht werden. Die wissenschaftstheoretischen Herleitungen der Begrifflichkeit, die für die Thesen genutzt werden, werden an dieser Stelle nicht erwähnt. Es sei aber angemerkt, dass sich der Aufsatz, und wie ein Überfliegen der weiteren Texte vermuten lässt, des gesamten Buches für jeden sehr lohnt, der oder die in Bildung und vor allem Bildung unter den Bedingungen der Digitalität interessiert ist. Verkürzungen der Thesen, Pointierungen und Auslassungen bitte ich zu entschuldigen und freue mich wie immer über Kommentare, die diesen Beitrag präzisieren.
Einführung
Schon in der Einleitung in den Sammelband wird die Sichtweise auf Bildung in einer Kultur der Digitalität (mehr dazu hier), wie Stalder den gesamtgesellschaftlichen Blick auf die Verwicklung zwischen Gesellschaft und Digitalem nennt, definiert. Es geht eben nicht um einen isolierten, instrumentellen Blick auf Medien, mit denen eine bloße Optimierung oder Effektivitätssteigerung der zuvor schon definierten Inhalte erreicht werden kann. Vielmehr geht es um das "kollektive Miteinander" und "Handlungsvollzüge" (Allert et al. 2017, S.10), also zunächst einmal um ein Bildungsverständnis, das sich an der Praxis orientiert (Praxis meint hier weniger den geläufigen Gebrauch eines Gegenteils von Theorie, sondern vielmehr die gemeinsame Praxis, die durch kommunikatives Handeln entsteht und so schon Teil des später weiter ausgeführten Bidungsverständnisses ist, vgl.S.46ff.). Die Konsequenz eines solches Blickes ist, dass das Digitale (also das, was zuweilen zum "Werkzeug" reduziert wird), weniger ein isolierbares Artefakt ist, als ein Subjekt, aus dessen Nutzung eine Wechselwirkung entsteht. Sowohl gegenüber dem Einzelnen als auch gegenüber dem Kollektiv (oder der Gemeinschaft), in dem/ der gehandelt wird. "Die Person erscheint in diesem Zusammenhang weniger als eine Gewordene, sondern eine in praktischen Bezügen ständig Werdende" (Ebd. S.15). Diese klassische Sicht führt insofern zu einem neuen Bildungsverständnis, das in der Einführung die Hauptthese des Artikels wie folgt auf den Punkt bringt:
"Kernaussage des Aufsatzes ist, dass in der digitalen Kultur nicht mehr von einem reflexiv-distanzierenden (und mentalistischen) Menschen im Bildungsprozess ausgegangen werden kann, sondern von einem performativen Selbst." (S.18).
Thesen und Anmerkungen
(1) "Bildungstheorien sind notwendigerweise immer an die gesellschaftlichen Bezüge ihrer Zeit gebunden." (S.27)
Wenngleich dieser erste Satz des Aufsatzes trivial erscheint, ergibt sie doch zwei interessante Konsequenzen. Zum einen verdeutlicht sie, dass jede bildungstheoretische Annäherung, die die Kultur der Digitalität ernst nimmt, zeitgemäß in dem Sinne ist, dass sie der Zeit entsprechend formuliert ist. Zum anderen zeigt sich, dass eben genau diese Erkenntnis, dass ein neues Bildungsverständnis in einer Kultur der Digitalität formuliert werden sollte, noch nicht erreicht ist.
(2) "Wir verorten Bildung innerhalb der Verworrenheit in soziomateriellen Praktiken. Bildung kann nie abschließend bestimmt werden." (Ebd.)
Fernab davon, dass hier die schon erwähnte Verworrenheit eine Rolle spielt, ist die Aussage der Unbestimmbarkeit insofern relevant, als dass sie auf den sich ständig erneuernden Prozess bezieht. Ein Satz, den viele ernst nehmen sollten, die der Meinung sind, dass doch nun genug theoretisch besprochen sei. Es zeigt sich: Es geht nicht um ein Definitives, das dann abgesegnet wird, sondern um ein kollektiv ausgehandeltes Blitzlicht, das sich in der Veränderung der Bedingungen wieder ändern kann - und muss.
Aus diesem Grund geht es in dem Aufsatz auch nicht um die zentrale Kategorie der Digitalität, sondern "Unbestimmtheit" (S.28f.). "Die Transaktionen an den Übergängen von Unbestimmtheit zu Bestimmtheit und von Bestimmtheit zu Unbestimmtheit". Inwiefern dies für das momentane Bildungssystem von Relevanz ist, wird später weiter ausgeführt. Es sei aber schon angemerkt, dass der Begriff der Unbestimmtheit gegenüber der Bestimmtheit darauf rekrutiert, dass Bildung eben kein definitives Inhaltsspektrum ist, das quasi abgearbeitet werden muss, sondern dass in den Leerstellen (örtlich, zeitlich, inhaltlich) das Potenzial einer produktiven Aushandlung inne wohnt. Dieses "transaktionale Bildungsverständnis" (Ebd.), das auf zahlreichen weiteren Kategorien beruht, die an dieser Stelle zunächst beiseite gelassen werden, basiert auf einem "prozessontologischen Verständnis" (Ebd.). Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die von Hörning zitierte Erkenntnis ernstzunehmen ist: "Die Welt, die wir geformt haben, formt auch uns". (Hörning 2001, zitiert nach Allert et al. S.15).
Auf der Grundlage eines solchen Verständnisses ist deutlich, dass eine Sicht auf digitale Medien als neutrale Werkzeuge für die Distribution, Planbarkeit und Optimierung von bestehenden Inhalten zu kurz kommt. Die ausgeführte Kritik, die sehr lesenswert ist, wird an dieser Stelle ausgelassen. Die sich darauf ergebende Frage ist allerdings zentral:
"Aus der pädagogischen Perspektive auf Digitalität stellt sich weniger der Frage, wie wir digitale Objekte wie Whiteboard und Tablets ins Klassenzimmer bringen und Einsatzszenarien dafür finden, sondern wie wir den Umgang mit Unbestimmtheit (sic) in einer Kultur der Digitalität im Hinblick auf Bildung gestalten können." (S.30).
Dazu wird konstatiert:
"In performativen Praktiken, in denen jeder einzelne Beitrag auch seinen Kontext mitproduziert, beteiligen wir uns alle zunehmend an der Produktion von Unbestimmtheit." (S.31).
Konkret: Ein Beispiel dafür, inwiefern diese Praktik zutrifft, ist die (Nicht-)Rezeption dieses Beitrags. Sofern beispielsweise im #twitterlehrerzimmer Diskursteilnehmer*innen den Beitrag lesen und für gut heißen, könnte (eine durchaus intendierte) Besprechung stattfinden, die in weitere Überlegungen eingehen, die vom Autor nicht geplant (also bestimmt) werden können. Genau so ist es aber möglich, dass keine Reaktion erfolgt oder dass eine Reaktion erfolgt, die die Thesen oder sogar die methodische Zugangsweise (als Blogbeitrag, die Vorstellung von Thesen etc.) kritisiert und alternativen vorschlägt. All jene Möglichkeiten der Weiterverarbeitung wären im Lernprozess der Teilnehmer (mit dem Gegenstand "Lernen in der Kultur der Digitalität") eine Aushandlung, die Unbestimmtheit produziert. Innerhalb einer schulischen Bestimmtheit könnte hingegen einfach die Aufgabe formuliert werden: "Schreibe die Thesen aus dem Blogbeitrag heraus." Natürlich würden hierbei möglicherweise Leseprozesse angeleitet werden. Aber eine kreative Auseinandersetzung im Sinne einer gemeinschaftlichen Aushandlung innerhalb der Kultur der Digitalität kann so freilich nicht stattfinden.
(3) "Digitalität ist jedoch nicht ein Programm, das NutzerInnen ausschalten können, oder eine Umgebung, in die sie sich nicht begeben müssen, wenn sie das nicht wollen, sondern bedeutet die Informatisierung der Gesellschaft." (S.31)
Diese Aussage lässt keinen Zweifel am Handlungszwang der an der Bildung Beteiligten. Denn egal, ob man die gerade stattfindende Entwicklung vornehmlich als "Leitmedienwechsel" (Döbeli-Honegger), "Paradigmenwechsel" (Krommer), "digitale Gesellschaft" (Nassehi) oder eben "Kultur der Digitalität" (Stalder) fasst: Es geht nicht um Argumente, sondern um die Annahme einer schon stattfindenden Transformation (Anmerkung: Die hier nebeneinander gestellten Definitionen sind streng genommen keine sich widersprechende Perspektiven auf die Transformation, sondern sich ergänzende Teilbereiche, deren Fokus sich unterscheidet; man könnte auch sagen, dass der Leitmedienwechsel ein Charakteristikum der Kultur der Digitalität ist, der als Paradigmenwechsel präzisiert werden kann).
Bevor es zur nächsten These geht, sei angemerkt, dass es im weiteren Verlauf (für mich zunächst erstaunlicher Weise) unter anderem auch um eine Kritik an Makerspaces geht. Die hier geschaffenen Räume seien zwar kreativ im Umgang mit Medien, ignorierten aber die Diskurse über Ethik etc. innerhalb der Kultur der Digitalität (vgl. S.35).
(4) "In der Auseinandersetzung mit der Welt wird nicht nur das Selbst- und Weltverständnis im Inneren der Person, sondern auch die äußere Situation transformiert, da die Auseinandersetzung eine produktiv/ gestaltende in der Welt ist. Das Epidemische wird ontologisch." (S.35)
In dieser These steckt die Kernaussage dafür, was in dem Begriff der "transaktionalen Bildung" zum Ausdruck kommt (oder eben der Bildung als produktive Verwicklung). Es geht eben nicht um eine mediale Umformung eines gegebenen Ziels (beispielsweise im Sinne eines Erklärvideos zu einem definierten Inhalt), sondern vielmehr um eine Prozess, der nicht nur die Erkenntnis des Einzelnen (also das Epidemische), sondern auch die Gestaltung dieser Erkenntnis in der und als Welt verändert (also das Ontologische). Auf den Punkt: "Interagieren und Erkennen sind aufeinander bezogen und konstituieren gemeinsam Realität."
Innerhalb dieser etwas abstrakten Gedankenfigur konkrete Beispiele zu finden, ist nicht allein deshalb schwierig, weil es bedeutet festzuhalten, was eben nicht zuvor bestimmbar ist. Dennoch: Der gescheiterte Lernprozess der Volkspartei CDU war es, die Bedingungen der Digitalität nicht zu verstehen, die das Video "Die Zerstörung der CDU" von Rezo ermöglicht hat. Diese sollen nicht aufgezählt werden, sondern es soll deutlich werden, dass die Unbestimmbarkeit hier als Merkmal eben jenes Lernprozesses fruchtbar gemacht wurde, den jeder "durchleben" konnte, indem er oder sie sich wiederum produktiv mit dem Video auseinandergesetzt hat. Innerhalb eines sehr starren Rahmens, den Schule meist darstellt, sind solche Räume meist nicht gegeben oder sie fallen allenfalls als den intendierten Ablauf störendes "Abfallprodukt" an. Und das ist nicht nur schade, sondern explizit problematisch, weil es Problemfaktoren unterdrückt, die reflektiert werden könnten, wenn man den Raum dafür geben würde. Anders gesagt:
(5) "Repräsentationale Modelle über Gegenstandsbereiche der Welt basieren auf der Annahme, dass Entitäten und deren Eigenschaften sowie Regeln feststehen, beschrieben werden können und einer Handlung vorausgehen." (S.36)
Oder übersetzt: Die Klassenarbeit über den im Schulcurrriculum bestimmten Inhalt wird innerhalb von zwei Stunden in Raum 8 am bestimmten Termin durchgeführt, nachdem das genau für diesen Zweck akkumulierte Wissen angehäuft worden ist. "Das Medium der Bildungspolitik ist Regulierung, Steuerung und Planung." (S.45).
(6) "Situationen sind nicht gegeben, die an ihr Beteiligten Akteure können sie nicht als unabhängige Beobachter repräsentieren." (S.37)
Ich möchte diesem Zitat ganz unwissenschaftlich die Augen küssen. Aus Gründen. Weiter im Text und entschuldigen Sie, werte/r Leser*in, diesen kurze, völlig unkontextuierten Einwurf.
(7) "Bestimmtheit ist nicht Ausgangspunkt menschlicher Interaktion und Kreativität, sondern ist stets im Entstehen - erzeugt durch Interaktion und die Stabilisierung von Prozessen." (...) Praxis muss neu erzeugt werden." (S.38)
Diese These ist nicht nur im Rahmen des Bildungs-, sondern auch des Netzdiskurses interessant, da eine "Stabilisierung von Prozessen" eben auch durch Interaktion erzeugt wird. Mit anderen Worten: Erst durch die produktive Rezeption von Ideen und Gedanken werden diese geformt, verändert und zurückgewiesen. Das ist per se nicht neu, sondern quasi Kernbereich von Ideengeschichte (also dem historischen Nachvollzug von der Genese bestimmter und eben dadurch bestimmbarer Ideen).
Innerhalb einem auf einen Themenkomplex wie das #twitterlehrerzimmer Diskurs bedeutet dies aber eben, dass das ständige Lamentieren über jene, die Ideen von anderen nicht neu fassen, aber eben in ihre eigenen Worte kleiden (oder in grafische Vorlagen formen) an der Kultur der Digitalität vorbei geht. Mit anderen Worten. Eine eigentlich negative Aussage wird so zum positiv konnotierten Plädoyer: Es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Das Beharren darauf, dass doch bitte nur eine Plattform, ein Blog oder eine Seite für eine Sammlung, Meinungsbeiträge oder Linksammlungen genutzt würden, ist zwar in manchen Fällen nachvollziehbar (die Rezipienten wissen im besten Fall, wo sie suchen müssen). Aber im Grunde ist es ein genauso hilfloser Versuch, das Unbestimmbare bestimmbar zu machen.
Das bedeutet im Falle der Bildung aber nicht, dass hier sogenannten "repräsentativen Modelle" (also beispielsweise die Institutionen dessen, was Bildungssystem genannt wird) keine Rolle mehr spielen.
(8) "Repräsentationale Modelle werden schon deshalb konstitutiv, weil die Kategorien mit denen Situationen bestimmt werden, bereit festgeschrieben und nicht in der Situation ausgehandelt werden. Die Kategorien mit denen Bildung geschrieben wird, konstituieren das Feld." (S.38)
Dies wird an dieser Stelle nicht im Detail ausgeführt, zeigt aber, inwiefern es im digitalen Diskurs entstandene Begriffe schwer haben, gegen wissenschaftlich gewachsene Herleitungen anzukommen. Das hat auch einen guten Grund, denn im Entstehensprozess wird eben jene Bestimmbarkeit sichtbar, die es braucht, um einen Rahmen zu haben, innerhalb von dem Aushandlungsprozesse überhaupt fruchtbar werden können. Mit anderen Worten: Dadurch, dass Bestimmbarkeit Unbestimmbarkeit mit erzeugt (vgl.S.31), kann sichergegangen werden, dass auch transaktionale Bildung nicht in Willkür mündet. Die Realität entsteht zwischen diesen Polen:
(9) "Zwischen dem repräsentational Angenommenen und dem performativ tatsächlich Hergestellten, bzw. der sich entfaltenden sozialen Praxis, kann eine Differenz bestehen, ein Widerspruch erwachsen - während gleichzeitig Realität entsteht."
Während wir den einen Pol sehr genau kennen, erwächst der andere Pol, also die "sich entfaltende soziale Praxis" innerhalb der informellen Räume.
(10) "Es genadelt sich hier also um ein ständiges relationales Wechselspiel, in dem (...) im Tun, in der Involviertet in Praktiken Situationen erzeigt und Realität verändert wird." (S.47)
Diese Aussage ist eigentlich selbsterklärend, verweist aber möglicherweise auf ein Defizit bestehender Bildung. Denn hier werden ja durchaus prozessuale Kompetenzen den Mittelpunkt schülerzensierten Arbeitens gestellt (freilich nicht immer umgesetzt). Der große Unterschied zu einer transaktionalen Bildung ist aber, dass der Prozess innerhalb eines Rahmens stattfindet, der eben (im besten Fall) epistemologische Prozesse meint, keine ontologischen.
Mit anderen Worten: Das physische Poster im Klassenzimmer über Marc Zuckerberg mag in der Gestaltung einen Lernprozess über den Facebook-Gründer in Gang gebracht haben (und im besten Fall ästhetische Kompetenzen in den Blick genommen haben, die als Teil der Präsentation des angeeigneten Wissens wichtig sind). Aber die dadurch entstandenen Nebenprodukte (Zuckerberg-Memes, Forums-Diskussionen, ein Youtube-Video mit einer Verschwörungstheorie) wird dabei nicht tangiert. Oder aber schon, aber erst innerhalb eines neuen sozialen Rahmens, der mit der Schule dann nichts mehr zu tun hat. Aus meinem Verständnis ist der transaktionale Bildungsbegriff deshalb so stark, weil er schon bestehende Praktiken beschreibt und gleichsam benennt, warum diese unter den vorhandenen Bedingungen schwer integriert werden können. Gleichzeitig wird aber ein Ausweg daraus ersichtlich:
(11) "Durch die Schaffung von Routinen und Praktiken lässt sich Bestimmtheit laufend herstellen, wobei die Praktiken emergent und performativ sind." (S.48)
Diese Aussage lässt sich auf die Situation des digitalen Fernunterrichts in der Corona-Krise anwenden. Eine Praktik kann als Routine in institutionelle Kontexte eingebunden werden, bleibt aber emergent, indem sie durch nicht vorhersehbare Störungen neue Räume herstellt. Dabei hängt viel vom Individuum ab, allerdings nicht, indem Medien passgenaue Individualisierung herstellen (instrumentelle Sicht, vgl. Kritik S.55), sondern: "Kognitive Kapazität liegt (...) nicht mehr nur beim Individuum(,) sondern auch in kollektiven Formen bzw. in der Verwiesenheit aufeinander." (S.50). Diese können dort entstehen, wo eben jene oben genannten Räume bzw. Leerstellen entstehen.
(12) "In immer neuen Segmenten und in den Leerstellen klassischer Institutionen entwickeln sich gemeinschaftliche Formationen, die durch ihre je eigenen Praktiken konstituiert werden." (S.50)
Auch hier könnte man das #twitterlehrerzimmer als lose, an Themenclustern orientierte Formation sehen, deren Ideen außerhalb der klassischen Institutionen entstehen, aber in diese diffundieren. Die Teilnehmenden werden von anderen Teilnehmenden aufgenommen: "Subjekte werden Teil einer Gemeinschaft, wenn ihr Beitrag dort als Beitrag zur Gemeinschaft wahrgenommen und anerkannt wird." (S.51)
Wenngleich es hier um eine Anerkennung als Wahrnehmung und Akzeptanz geht, liegt hierbei auch ein besonderer Sog vor, den jeder wahrnehmen kann, der zunächst experimentierend dazu übergeht, Beiträge so zu formulieren, dass sie anerkannt werden. Diese Form der intentionalen Schaffung kann dazu führen, dass die Beiträge stagnieren (aber natürlich dennoch innerhalb der Schaffung von Gemeinschaftlichkeit und gemeinschaftlicher Praxis wirken). Insofern als das die Teilnehmenden nicht durch eine institutionell zertifizierte Statusangabe, sondern durch die Teilnahme am Diskurs wahrgenommen werden, konstituieren sie sich durch die Praktik selbst:
(13) "Die Idee des performativen Selbst sieht das Entwerfen und entworfen werden und das in der Situation und in Bezug auf die jeweiligen gemeinschaftlichen Formationen Hergestellte als profund an." (S.51)
Auch wenn die Herleitung der nächsten Aussage sehr spannend ist, muss sie hier ausgelassen werden. Dennoch ist sie (so wie alle hier erörterten Thesen) für ein Nachdenken über Bildung in Zeiten des digitalen Wandels zentral.
(14) "In transaktionalen Interaktionen, in der Überführung von Bestimmtheit in Unbestimmtheit und in anschließenden Aushandlungsprozessen zur Konstitution neuer Praxis und Bestimmtheit realisieren die Beteiligten Akteure Reflexion und Kritik." (S.59)
Dies lässt sich relativ einfach auf den Vernetzungsdiskurs übertragen, innerhalb dem die Beteiligten die Genese einer Idee wahrnehmen oder an ihr mitschaffen, die dann beispielsweise als Leitlinie in den Bildungsplan aufgenommen wird. Meine eigene Erfahrung ist, dass genaue jene "Transaktion", also die Beteiligung am Aushandlungsprozess erst in die Lage versetzt, dass der Ausgang und das Ergebnis beurteilt werden kann (als Reflexion, wie es einen selbst und die Gemeinschaft betrifft und als Kritik demgegenüber, was intendiert gewesen ist).
Für die Schule wären solcherlei Aushandnlungsprozesse wünschenswert - sowohl in Bezug auf die transaktionale Bildung selbst als auch in der Zielsetzung der Reflexion und Kritik als Verstehensprozess, der auf der eigenen Aneignung beruht (auch hier, sehr vereinfacht: Erst durch die produktive Gestaltung von FakeNews wird die Machart deutlich). Auf den Punkt gebracht: "Reflexion findet in der Verworrenheit mit der Praxis statt."
(15) "Der produktive und kreative Umgang mit inhärent unbestimmten Situationen ist Grundlage des transaktionalen Bildungsverständnisses. Wir sprechen deshalb auch von Bildung als produktiver Verwicklung." (S.62)
Dies ist als Fazit geradezu selbsterklärend. Da es sich aber grundsätzlich auch auf den Titel dieses Beitrags bezieht, sollte es hier nochmals wiederholt werden.
(16) "Die auf performativen Praktiken basierende Kultur der Digitalität erfordert permanent Aushandlungsprozesse, die kontingent sind. Dies können Bildungseinrichtungen, die Medien instrumentell einsetzen um Bestimmtheit zu vermitteln, nicht leisten. Während Praktiken aller Lebensbereiche (...) neu bestimmt werden, finden Unbestimmtheit und Innovation in stark regulierten Bildungssituationen kaum statt." (S.62)
Jenseits der Tatsache, dass auch jenes Zitat gleichsam Fazit und Bestandsaufnahme ist, ist das Verb der Stunde hier "erfordern". Denn aus ihm geht gleichsam ein Plädoyer hervor, das den Beitrag aus einer zunächst beschreibend-definitorischen Perspektive herausrückt. Die Erfordernis wird konstatiert. Und zwar unter den Bedingungen, die schon gegeben sind. Deutlicher kann man den Wunsch nach einer Veränderung kaum auf den Punkt bringen.
Fazit
Das transaktionale Bildungsverständnis, das in dem hier besprochenen Beitrag erläutert wird, ist eines, das aufgrund zahlreicher plausibler Kategorien zu verstehen hilft, wie Bildung unter den Bedingungen der Digitalität funktionieren kann.
Ich hoffe sehr, dass dieser Artikel es schafft, den Beitrag nachvollziehbar zu machen und ihm einen breiten Publikum eröffnet, da ich denke, dass er nicht nur präzise, sondern auch anschlussfähig für weitere Überlegungen von netzbasiertem und zeitgemäßem Lernen ist.
Ich freue mich über Feedback, Rückmeldungen und Kommentare.
10 comments on “DIGITAL: Bildung als produktive Verwicklung”
-
-
Das war dann wohl die Autokorrektur. Danke für den Hinweis. Es ist immer "transaktional" gemeint.
-
-
Wichtig, hilfreich, notwendig. Klare Leseempfehlung!
-
Das freut mich sehr!
-
-
[…] DIGITAL: Bildung als produktive Verwicklung […]
-
Horning wird zitiert. (Die Welt die wir geformt haben formt uns auch.) Ich glaube Ernst Cassirer hat das in den fünfziger Jahren schon gesagt.
Herr Logue
Kalifornien -
"Produktive" Verwicklung? In welchem Sinne "Produktive"? Ist es immer der Fall das es "produktive" sein solle? Ich stelle die Frage nur.
Herr Logue
Kalifornien -
[…] https://bobblume.de/2020/06/10/digital-bildung-als-produktive-verwicklung/, aufgerufen am […]
-
[…] Die verschiedenen Merkmale der Kultur der Digitalität (Gemeinschaftlichkeit, Referentialität, Algorithmizität) führen zu einer Erweiterung der Möglichkeiten und zu einer produktiven Verwicklung. […]
-
[…] dem Aufsatz „Bildung als produktive Verwicklung“, den ich auf diesem Blog schon gelobt habe, schreiben Asmussen und Allert von der Emergenz einer […]
Schreibe einen Kommentar zu Bob Blume Antwort abbrechen









